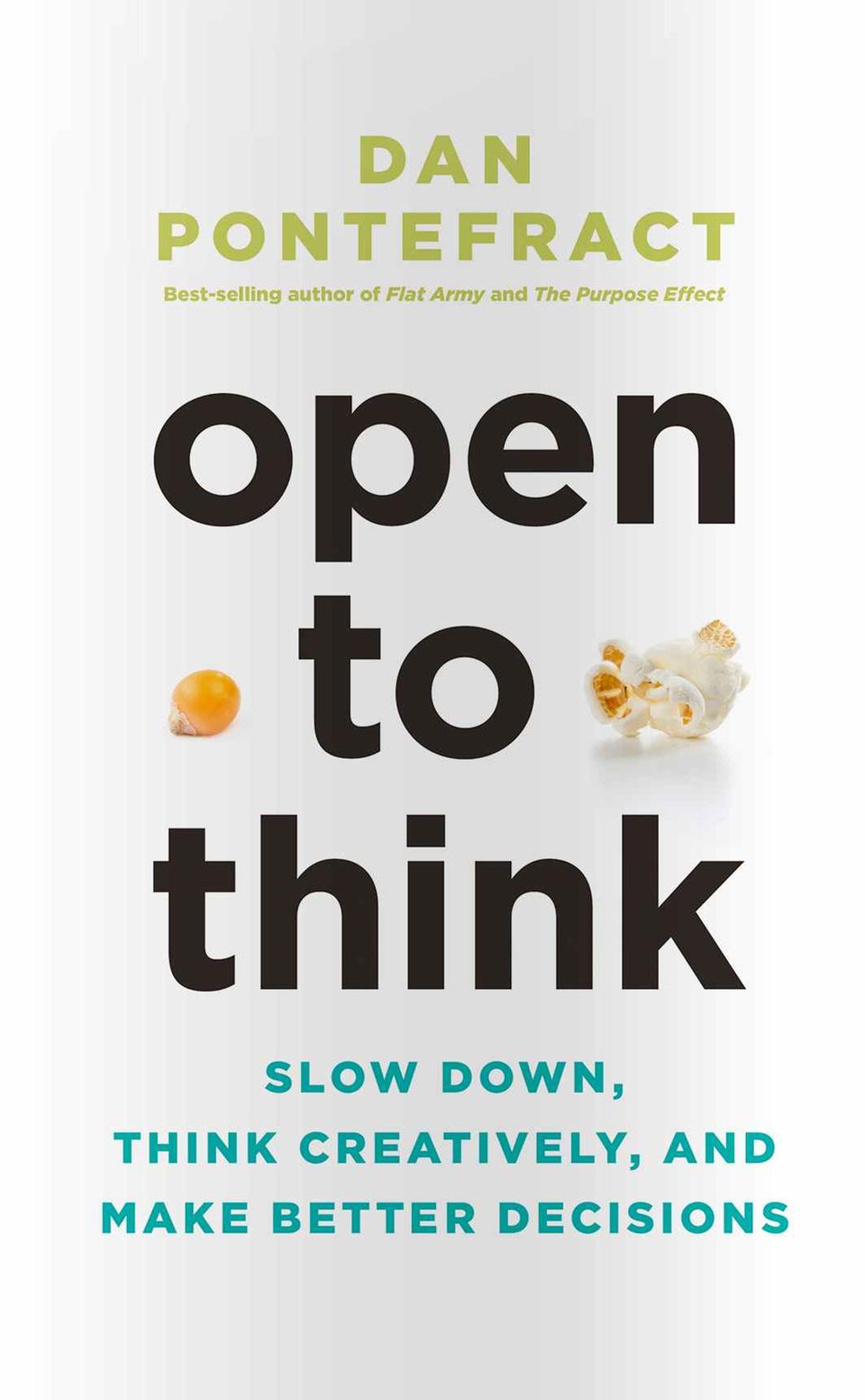Dan Pontefract : Der Berater aus Kanada setzt Akzente zur Transformation von Unternehmenskultur und ist gefragter Redner und Gastautor bei „Forbes“ oder „Harvard Business Review“. Capital hat gemeinsam mit dem Wissensvermittler getAbstract die vier besten Wirtschaftsbücher 2019 gekürt – darunter: „Open to Think“, Dan Pontefract, Figure 1 Publishing, 2018
Herr Pontefract, Sie sagen, wir müssten wieder mehr nachdenken. An wen denken Sie da besonders?
DAN PONTEFRACT: Ich beobachte seit 25 Jahren, wie Firmen und Mitarbeiter geführt werden. Erst war ich selbst in Unternehmen Chefplaner, Lernbeauftragter oder Abteilungsleiter für Bildung und Entwicklung. Dann habe ich aus der Außenperspektive beraten. Ich sehe mich als eine Art Unternehmenssoziologe und stelle fest, dass sich die Lage, was Engagement und Einsatzbereitschaft von Mitarbeitern angeht, zum Schlechteren verändert hat.
Das klingt hart – aber kann man das überhaupt so pauschal sagen?
Wir haben im Streben nach immer mehr Leistung, Effizienz und Engagement die Technologie zum Heiligen Gral erklärt. Digitalisierung sollte Zeit sparen. Aber vor den Leuten – und das gilt für Führungskräfte und deren Mitarbeiter gleichermaßen – türmen sich immer höhere Berge elektronischer Inhalte auf. Statt unser Handeln schneller und besser zu machen, begünstigt die Technik grundsätzlich eine Kultur der Furcht und des Aktivismus. Wir vergessen, dass wir nicht aus Einsen und Nullen gemacht sind, sondern aus Molekülen. Menschliche Führungsqualitäten, die beispielsweise ein Klima des Vertrauens schaffen und Mitarbeiter fördern, werden von rein prozessorientierten und optimierten digitalen Transaktionen verdrängt. Im Ergebnis legt sich über alles eine Kultur der permanenten Betriebsamkeit und des Multitasking, und wir müssen uns den Raum und die Zeit zum Nachdenken und Überlegen zurückholen.
Wie kommen Sie zu dieser Diagnose?
Die Frage ist, wie kreativ und aufmerksam geht ein Unternehmen mit Ideen und Entscheidungen um? Das lässt sich daran messen, wie die internen Abläufe gestaltet sind, wie die Menschen sich einbringen und wie stark sie zusammenarbeiten. Ist die Kultur übermäßig top-down, hierarchisch und bürokratisch oder fürchten Mitarbeiter Veränderungen, dann ziehen sie sich tendenziell zurück – im Denken wie im Handeln. Stellen Sie sich eine Matrix vor: Die y-Achse zeigt den Grad und die Tiefe von Reflexion, die x-Achse die Bereitschaft und Möglichkeit zu handeln. In 70 bis 80 Prozent der Unternehmen schalten die Menschen ab, weil sie einer unaufhörlichen Flut von Aufgaben ausgesetzt sind oder in einem Klima der Angst leben.
Und dann driften sie in die innere Immigration oder reagieren nur noch?
Wenn Mitarbeiter verängstigt sind, weil nur der Chef entscheidet und Fehler nicht toleriert werden, dann sind sie wie gefesselt oder gelähmt: Sie sitzen still, halten sich aus allem heraus, sind unschlüssig, entwickeln sich nicht weiter und sind also weder kreativ noch risikobereit, geschweige denn innovativ. Und zweitens schafft Führungspersonal zunehmend ein Umfeld, in dem jeder permanent auf Empfang und Sendung sein muss. Es passiert einfach zu viel. Die Menschen sind mit telefonieren beschäftigt, schubsen E-Mails weiter, sichten neue Textnachrichten, ein Meeting jagt das andere. Das lenkt vom Wesentlichen ab, wir denken nicht mehr mit, und das führt dazu, dass wir am Ende schlecht entscheiden.
Tatsächlich ist der Arbeitsalltag ja oft dicht gedrängt. Aber wie kann man das ändern?
Aus der Sicht eines Unternehmens muss man damit beginnen, die eigenen Normen zu hinterfragen. Was sind die Erwartungen an Dinge wie Konferenzen: Wie viele braucht es, wie lange sollen sie dauern? Hat man schon einmal ausgewertet, wie produktiv die Sitzungen sind oder ob sie nur geschäftige Rituale sind? Wer nimmt teil, geht es interaktiv zu, oder ist die Kommunikation einseitig?
Steht das nicht in vielen Ratgebern?
Mag sein. Aber Menschen wünschen sich Interaktion, und Teams müssen sehen, wie sie ihre Abläufe und Umgangsformen auch mal reparieren können. Und zweitens muss man auch genauer hinsehen, wie Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen teilhaben können oder ob das am Ende immer auf denselben Kreis hinausläuft. Manche Betriebe behelfen sich mit Kreativteams – als ob nicht jeder Mitarbeiter kreativ sein könnte. Und der eine oder andere „Field Day“ reicht auch nicht, um Elfenbeintürme aufzubrechen.
Und wie kann sich jeder Einzelne aufs Mitdenken besinnen?
Da hilft nur Selbstdisziplin. Man darf sich nicht der Übergriffigkeit der großen Technologieunternehmen hingeben. Ob das jetzt der Google- oder Outlook-Kalender ist, der deine Zeit in 60-Minuten-Konferenzen taktet … Es können auch mal 45 oder nur 18 Minuten sein. Schau dir deine Agenda genau an, ob du die Zeit sinnvoll verbringst. Viele Menschen denken, sie müssen an einem Meeting teilnehmen, um ihr Gesicht zu zeigen. Aber wenn du da 60 Minuten sitzt und nichts beizutragen hast, bist du im falschen Meeting. Wir müssen viel militanter und umsichtiger mit unserer Zeit umgehen.
Wie schaffen Sie das denn selbst?
Ich baue mir zwischen Besprechungen immer Puffer in den Tag. Ich will wirklich nicht von mir behaupten, dass ich perfekt bin. Oft sage ich mir: Dan, du hättest die Woche besser organisieren können. Aber eine Sache ist mir heilig: Ich halte mir immer den Freitagnachmittag frei. Das ist meine Denkzeit. Ich hole Versäumtes nach, setz mich auf mein Fahrrad, um die Gedanken schweifen zu lassen, oder lasse Erlebtes Revue passieren. Dafür nehme ich mir ungefähr vier Stunden und halte das seit vielen Jahren durch. Wir müssen, jeder für sich, egoistischer sein mit unserer Zeit.
Unterscheiden Sie in der Zeit auch zwischen kreativem, kritischem und angewandtem Denken wie in Ihrem Buch?
Nein, das tue ich nicht. Aber ich habe dieser Tage im Flugzeug zum Beispiel für Januar und Februar 40 bis 60 Stunden blockiert, die ich an kreativer Denkzeit brauche, um ein Onlineseminar zu entwerfen, das im September anlaufen soll. Das ist der Plan: ich, ein Whiteboard und hier und da ein Mitarbeiter dazu. Außerdem reserviere ich etwa 20 Stunden mit meinem Lektor. Das ist nicht wirklich kreativ, aber muss eben gemacht werden. In der Zeit werde ich keine E-Mails anfassen, nichts schreiben und Redetermine ablehnen.
Können Sie von sich behaupten, dass Sie jetzt bessere Entscheidungen treffen?
Ganz sicher. Ich sitze zum Beispiel in einem Haus, das ich selbst mit meiner Frau entworfen habe. Die Planung lief praktisch zwei Jahre parallel zu den Entwürfen für „Open to Think“. Ich wollte kreativ herangehen und habe erst sechs Wochen lang Onlinekurse für Architektur belegt, dann haben wir mit einer Architektensoftware viele Testschleifen gedreht, wie das Haus aussehen sollte. Erst am Ende hat ein Profi noch praktische Änderungen vorgeschlagen. Aber wir folgten im Grunde dem Mantra „Träume, entscheide, handle, wiederhole“, ohne zu der Zeit zu wissen, dass es Kern meines Buches werden würde.
Wissen Sie schon, wovon Ihr nächstes Buch handeln wird?
Es wird eine Langzeitstudie, wie Führungskräfte mit bestimmten Charaktereigenschaften wie Integrität oder Bescheidenheit eine bessere Umgebung für Zufriedenheit und Selbstverwirklichung schaffen.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden