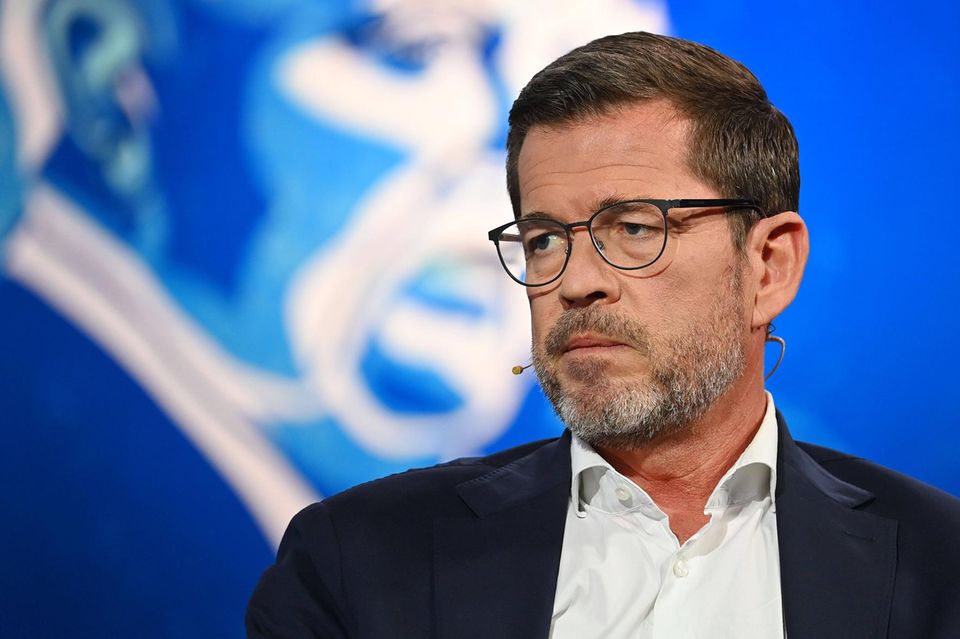Herr Melzer, die Regierung garantiert bis zu 13 Cent pro Kilowattstunde, wenn sich ein Privatmensch verpflichtet, den Strom der Anlage immer ins Netz zu geben und nie selbst etwas zu verbrauchen. Da stellt sich die Frage, wie hoch sind die Vollkosten für so eine Anlage? Also kann ich, wenn ich Wartung, Reinigung, Installation etc. in Rechnung stelle, den Strom für weniger als 13 Cent herstellen?
ALEX MELZER: Ja, das ist möglich. Die Stromgestehungskosten für eine Photovoltaikanlage ohne Batteriespeicher mit 10 kWp Leistung und 30 Jahren Laufzeit belaufen sich auf rund 9 ct/kWh. In diesen Kosten ist die Investition in die Anlage sowie Kosten für Installation, Wartung und Reinigung bereits enthalten. Entscheiden sich Hausbesitzende für die Volleinspeisung ihres Solarstroms, würden sie demnach 4 Cent Gewinn pro ins öffentliche Netz eingespeister Kilowattstunde Strom machen.
Immerhin 4 Cent. 9 Cent Kosten für den selbstgemachten Strom sind erfreulich niedrig, wenn man auf die Stromrechnung schaut. Wie stark verteuert ein Batteriespeicher diesen Strom?
Die Stromgestehungskosten einer vergleichbaren Solaranlage inklusive Batteriespeicher liegen bei etwa 12 ct/kWh. Wie Sie andeuten, liegt der Fokus hier nicht auf dem Gewinn durch die Einspeisevergütung, sondern viel mehr darauf möglichst viel des erzeugten Solarstroms selbst zu nutzen und nur einen Teil des Stroms ins öffentliche Netz einzuspeisen. So sparen Verbraucher gegenüber dem aktuellen Strompreis von 36 ct/kWh rund 24 Cent pro Kilowattstunde, die sie an Strom verbrauchen, und erhalten dennoch 8,2 ct/kWh für überschüssigen Strom, den sie ins Netz einspeisen. Die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage ist bei möglichst hohem Eigenverbrauch des Solarstroms deswegen deutlich höher als bei der Volleinspeisung.
Doch zum Klimaschutz leisten beide Anlagen einen wichtigen Beitrag: ob Teil- oder Volleinspeisung, eine Solaranlage dieser Größe spart jährlich 4,7 Tonnen CO2 ein. Das entspricht sieben Hin- und Rückflügen von Hamburg nach Mallorca oder 20.000 Kilometer Fahrt mit einem Benziner.
Können wir das mal an einem Beispiel durchrechnen? Wieviel man produziert, wieviel man verkauft und wie groß der Gewinn in einem Jahr ist?
Nehmen wir eine 10 kWp Anlage als Beispiel, die klassischerweise auf einem Einfamilienhaus in Deutschland installiert ist, sowie einen Stromverbrauch von 4000 kWh pro Jahr, dem durchschnittlichen Stromverbrauch einer vierköpfigen Familie.
Nehmen wir die neueingeführte Volleinspeisung für die Musterfamilie „Müller“, dann kommen wir auf welche Werte?
Familie Müller hat sich für die Volleinspeisung entschieden und speist die übers Jahr erzeugten 9700 kWh Solarstrom vollständig ins öffentliche Netz ein. Dafür erhält sie vom Staat 13 Cent Einspeisevergütung pro Kilowattstunde, was ihnen einen Gewinn von 1261 Euro pro Jahr einbringt. Setzen wir dies in Relation zu den Investitions- und Wartungskosten, bleibt Familie Müller nach 20 Jahren ein Gewinn von 2239 Euro.
Das sind bescheidene 112 Euro im Jahr oder ganze 9,30 Euro im Monat. Ehrlich gesagt, haut mich das nicht um. Vielleicht ist die nächste Familie klüger.
Familie Bauer speist nur einen Teil ihres selbst erzeugten Solarstroms ins öffentliche Netz ein und nutzt so viel des Stroms wie möglich, um ihren eigenen Haushaltsbedarf zu decken. Dafür haben sie passend zur Anlagengröße und ihrem individuellen Stromverbrauch zusätzlich einen 5,1 kWh großen Batteriespeicher installiert. Ihr jährlicher Gewinn ergibt sich aus der Stromkostenersparnis gegenüber teurem Netzstrom zu aktuell 36 ct/kWh, sowie der Einspeisevergütung für den nicht selbst genutzten Solarstrom zu 8,2 ct/kWh. Beides kombiniert führt für Familie Bauer zu einem Gewinn von 1720 Euro pro Jahr. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Wartungskosten erwirtschaftet Familie Bauer nach 20 Jahren einen Gewinn von 19.110 Euro.
Das hört sich besser an. Hier kommen wir auf 955 Euro im Jahr oder 80 Euro im Monat. Die Entstehungskosten sind fix, sie bleiben über 20 Jahre konstant bei 12 Cent pro Kilowattstunde, aber wenn die Strompreise steigen, steigt die Ersparnis auch.
Richtig, wir leben in Zeiten, in denen der Strompreis sehr stark steigt. Zusätzlich kommt hinzu: Immer mehr Menschen fahren Elektroautos, installieren Wärmepumpen. Das bedeutet, dass auch der Stromverbrauch in Zukunft stark steigen wird. Mit steigenden Stromkosten und höherem Stromverbrauch wird der Vorteil der Eigenverbrauchsanlage über die Jahre immer größer werden.
Ich bezahle noch 36 Cent für den Netzstrom – Tendenz stark steigend – es ist also klüger, den Strom selbst zu verbrauchen?
Absolut, das ist auch unsere Empfehlung. Der wichtigste Hebel für die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage bis 30 kWp ist heute die Stromkostenersparnis gegenüber teurem Strom aus dem Netz. Nehmen wir wieder unsere Beispiel-Familien: Während Familie Müller mit ihrer Volleinspeiseanlage 13 Cent pro kWh Strom Gewinn erzielt, zahlen sie für ihren eigenen Strombedarf weiterhin 36 Cent/kWh für Strom aus dem deutschen Netz. Familie Bauer hingegen spart mit ihrer Eigenverbrauchsanlage 24 ct/kWh Strom, den sie nicht aus dem Netz beziehen und erhalten zusätzlich 8,2 Cent/kWh für den Solarstrom, den sie nicht selbst genutzt und ins öffentliche Netz eingespeist haben.
Das Modell Volleinspeisung wurde mit viel Pomp angekündigt und tatsächlich lohnt es sich nicht?
Unter sehr seltenen Voraussetzungen kann die Volleinspeisung tatsächlich wirtschaftlicher sein: für Haushalte mit kleinem Stromverbrauch und gleichzeitig großer Anlagenleistung. Dabei gilt als grobe Faustformel: Ist die Anlagenleistung so groß, dass mehr als 80 Prozent des erzeugten Stroms ins Netz eingespeist wird, kann eine Volleinspeiseanlage wirtschaftlicher sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haushalt mit einem sehr großen Dach einen in Relation derart niedrigen Stromverbrauch hat, ist allerdings sehr gering.
Sollten die Strompreise im kommenden Jahr wie erwartet sprunghaft ansteigen, sind Volleinspeiseanlagen für private Hausbesitzende fast immer unvorteilhaft. Für den absoluten Großteil der privaten Hauseigentümer kann daher klar zur Eigenverbrauchsanlage geraten werden. Eigenverbrauchsanlagen lohnen sich bereits jetzt, aber insbesondere machen sie Verbraucher unabhängig von steigenden Energiepreisen sowie Öl und Gas. Sie sind eine Investition in die Zukunft.
An der Einspeiserichtlinie stört mich das Wort "ausschließlich". Könnte ich auf einem Grundstück zwei separate Anlagen betreiben, und dann eine für mich nutzen und die andere „ausschließlich“ einspeisen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Es ist zulässig gleichzeitig eine Anlage zur Eigenverbrauchsdeckung und eine zur Volleinspeisung zu errichten. Jedoch haben solche komplexen Betreibermodelle auch Nachteile: Höhere Anschaffungskosten durch zwei separate Systeme und einen größeren Installationsaufwand. Zudem steigen das Ausfallrisiko und die Wartungskosten. Betreiber solcher komplexen Systeme erwartet eine komplexere Anmeldung und steuerliche Betrachtung. Im Vergleich zu einer einheitlichen Gesamtanlage sind solche Betreiberkonzepte auch weniger nachhaltig, denn sie binden unnötig viele Ressourcen, zum Beispiel zwei Wechselrichter. Für private Hausbesitzer sind diese Systeme aufgrund ihrer Komplexität und aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll. Solche Betreibermodelle werden Anwendung bei professionellen Investoren und Großanlagen finden.
Ein letzter Versuch: Für wen kann die Volleinspeisung überhaupt interessant sein? Etwa, wenn ich ein Grundstück habe mit Stromanschluss, aber ohne echten Verbrauch – würde das gehen? Also ein Ferienhaus, eine Hütte, ein Pferdestall oder freistehende Garagen?
Ja, im Kleinanlagensegment könnte die Volleinspeisung bei speziellen Betreiberkonstellationen Anwendung finden, bei denen der herkömmliche Eigenverbrauch unmöglich oder unwirtschaftlich wäre. Dazu gehört zum Beispiel ein Sommerhaus, das die meiste Zeit des Jahres nicht bewohnt ist. Für solche Gebäude, bei denen die installierte PV-Anlage nicht zur Eigenverbrauchsdeckung genutzt werden kann, stellt die Volleinspeisung eine sinnvolle Alternative dar, um die Energiewende voranzutreiben.
Ein unbewohntes Ferienhaus. Das ist allerdings eine kleine Nische. Das Modell Volleinspeisung lassen wir mal beiseite. Gehen wir noch mal zum Akku zurück. Ich kann Solarpanels installieren und den Strom entweder direkt verbrauchen und den Rest ins Netz schicken, oder ich kann meinen eigenen Strom speichern und nur möglichst wenig ins Netz speisen. Dann spare ich viel teuren Netzstrom ein, muss aber den Akku bezahlen. Lohnt sich das?
Unsere Berechnungen bei Zolar zeigen, dass die Kombination aus PV-Anlage plus Batteriespeicher im Allgemeinen wirtschaftlicher ist als reine PV-Anlagen. Die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage auf einem Ein- oder Zweifamilienhaus hängt heute primär von vermiedenen Stromkosten ab. Je mehr des Haushaltsstrombedarfs mit Solarstrom vom eigenen Dach gedeckt werden kann, desto wirtschaftlicher. Der Speicher unterstützt dabei, möglichst viel des erzeugten Stroms selbst zu verbrauchen. So scheint die Sonne gerade mittags am stärksten, während der meiste Strom in der Regel morgens und abends verbraucht wird. Bei PV ohne Speicher liegt die Autarkie, also der Anteil meines Stromverbrauches, den ich mit Solarstrom decken kann, bei etwa 30 bis 40 Prozent. Mit einem Speicher kann ich die Autarkie ohne weiteres auf etwa 70 bis 80 Prozent erhöhen. Bei der Auslegung der Solaranlage raten wir allgemein zur Dachvollbelegung. Die Kapazität des Speichers sollte dann entsprechend dem Stromverbrauch ausgelegt werden und der Rest wird per Teileinspeisung ins Netz gegeben.
Können Sie an einem Beispiel zeigen, wie teuer mich die Kilowattstunde kommt?
Die Stromgestehungskosten ergeben sich aus der Investition, minus je nach Verfügbarkeit einer Einmalförderung, plus die Betriebskosten, geteilt durch den Gesamtertrag der Anlage über den Zeitraum von 30 Jahren – denn so lange hält eine Solaranlage in der Regel.
• Betriebsdauer 30 Jahre
• Investition: 10 kWp PV, 5,1 kWh Speicher = Nettokosten 22.072 Euro
• Einmalförderung: hier vernachlässigt, da nicht bundesweit einheitlich. In Berlin würde ein Kunde aber beispielsweise einmalig rund 1800 Euro Förderung erhalten.
• Betriebskosten: etwa 1,5 Prozent der Investitionskosten pro Jahr
• Gesamtertrag: etwa 9700 kWh pro Jahr
• Mit Berücksichtigung der Moduldegradation von 0,5 Prozent pro Jahr
• Stromgestehungskosten = 12 ct/kWh
Angenommen, Sie haben ein Haus oder bauen eines, wo sich die Lage für Photovoltaik eignet. Welches Modell würden Sie persönlich wählen: Einspeisen, Panels oder Panels und Akku?
Bei Zolar empfehlen wir unseren Kunden allgemein PV plus Batteriespeicher mit Dachvollbelegung und Speicherdimensionierung nach Stromverbrauch. Viele unserer Kunden entscheiden sich zusätzlich für eine Wallbox, was hinsichtlich der Elektrifizierung der Mobilität absolut sinnvoll ist. Das erstrebenswerte Ziel von Photovoltaikanlagen heutzutage ist, grüne Energie bereitzustellen und Stromkosten einzusparen, indem möglichst viel des erzeugten Stroms selbst verbraucht wird. Daher ist der Eigenverbrauch vorteilhafter als die Volleinspeisung und mit Speicher vorteilhafter als ohne Speicher. Bei Zolar empfehlen wir eine Solaranlage ohne Speicher nur, wenn die Anlagenleistung [kWp] kleiner als die Hälfte des Stromverbrauchs [kWh]/1000 ist. Das wäre bei einem Verbrauch von 4000 kWh/Jahr eine Anlagenleistung von weniger als 2 kWp, weil zum Beispiel nicht genügend Platz für Module auf dem Dach vorhanden ist.
Noch mal eine Frage zur Kapazität der Anlage. Wenn ich auch an nicht so sonnigen Tagen meinen Bedarf decken möchte, muss ich mehr Kapazität haben, als ich an sonnigen Tagen aufbrauchen werde. Welche Anlagengröße an Panel und Akku würden Sie heute für einen Vier-Personen-Haushalt wählen – vorausgesetzt, dass man die Panels auch unterbringen kann?
Nehmen wir den durchschnittlichen Stromverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts in Deutschland von 4000 kWh/Jahr. Die durchschnittliche Kapazität unserer Kunden mit 4000 kWh Jahresverbrauch liegt bei etwa 15 kWp. Aus wirtschaftlicher Sicht empfehlen wir, diese voll zu belegen. Je größer die PV-Anlage desto niedriger ihre Stromgestehungskosten, da Fixkosten wie die Installation sowieso anfallen. Die Preise für Module sind im Langzeitvergleich stark im Preis gefallen, daher werden Anlagen relativ zu ihrer Dimension günstiger je größer sie sind. Der optimale Speicher hängt von verschiedenen Faktoren ab (Stromverbrauch, Anlagengröße, Verbrauchsverhalten). Unser Zolar-Online-Konfigurator berücksichtigt all diese Faktoren und berechnet für Kunden automatisch die optimale Größe des Speichers. Bei dem genannten Stromverbrauch von 4000 kWh/Jahr und einer Anlagengröße von 15 kWp empfehlen wir einen Speicher von 5,1 kWh.
In einfachen Worten übersetzt: Ich sollte soviel Panels aufstellen, wie ich irgendwie sinnvoll unterbringen kann. Erhöht sich mein eigener Stromverbrauch stark, kann ich recht nachträglich den Akkuspeicher erhöhen. Vielleicht kann ich auch ein E-Auto als Speicher einbinden. Um so meine Autarkie zu erhöhen, mehr eigenen Strom zu verbrauchen und weniger ins Netz zu geben.
Das wäre ein guter Plan, um Geld zu sparen, die Energiesicherheit zu erhöhen und etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.
Dieser Beitrag ist zuerst auf stern.de erschienen.