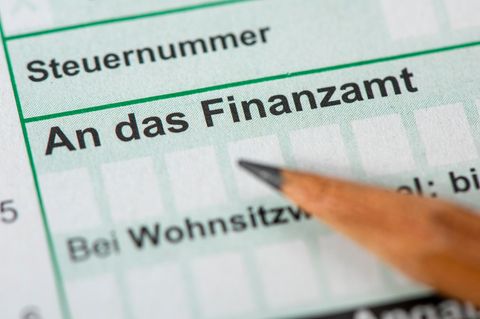Die neue Grundsteuer tritt zwar erst 2025 in Kraft, doch die wichtigsten Daten mussten Eigentümerinnen und Eigentümer per Feststellungserklärung bereits beim Finanzamt abliefern. Der Grund für die lange Vorlaufzeit: Die Reformbemühungen sind überaus komplex. 36 Millionen Immobilien müssen neu bewertet werden. Ein Faktor erntet dabei besonders Kritik – der Bodenrichtwert.
Beim Bodenrichtwert handelt es sich um den durchschnittlichen Grundstückswert innerhalb einer vorab definierten geografischen Zone. Er basiert auf den Grundstückskaufpreisen einer Gemeinde und der statistischen Nettokaltmiete. Er beeinflusst damit nicht nur mittelbar den Immobilienwert, wenn Eigentum verkauft oder vermietet werden soll. Gemeinsam mit der Grundstücksfläche bildet der Bodenrichtwert den Boden- beziehungsweise Grundstückswert, welcher wiederum maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Grundsteuer hat.
Neben Experten üben auch Lobbyverbände wie der Bund der Steuerzahler (BdSt) sowie Haus & Grund generelle Kritik an der Grunsteuer und am Bodenrichtwert im Besonderen. Steigende Immobilienpreise würden sich in höheren Bodenrichtwerten und damit höheren Steuerzahlungen niederschlagen. Ein Blick auf die Stadt Köln bestätigt diese logische Konsequenz, zumindest für die Vergangenheit: In der beliebten Wohngegend Altstadt Süd (etwa sechs Bodenrichtwertzonen) ist die Kennzahl von im Schnitt 1353 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2011 auf 3172 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2023 gestiegen – ein Plus von 134 Prozent. Hier scheint der Zusammenhang zwischen steigenden Immobilienpreisen und steigenden Bodenrichtwerten also klar gegeben.
Darüber hinaus kritisiert der Steuerzahlerbund, dass die Werte in Gegenden, wo viele Immobilien gehandelt werden, höher sind als in Regionen, wo Häuser nur selten verkauft werden. Auch das ist logisch, weil in der Regel jeder Verkäufer versucht, beim Verkauf Gewinn zu machen und das Grundstück mit einem höheren Preis zu verkaufen. Für Gegenden mit wenig Marktbewegungen würden dagegen veraltete Werte gelten. „Sozial gerecht oder fundiert ist das nicht“, schreibt die Interessensvertretung dazu auf ihrer Website. Beispiel Köln: In der Einkaufsstraße Schildergasse hat sich der Bodenrichtwert zwischen 2011 und 2023 nur um 11 Prozent von 27.000 Euro auf 30.000 Euro pro Quadratmeter verteuert.
Einspruch nur in begründeten Fällen sinnvoll
Den Bodenrichtwert ermitteln Gutachterausschüsse der Städte und Gemeinden der jeweiligen Regionen spätestens alle zwei Jahre. Anschließend veröffentlichen sie ihre Ergebnisse über das sogenannte Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS). Eigentümer und Mieterinnen können die Bodenrichtwertzonen in der Regel kostenlos über eine Adresssuche auf der Karte nachschauen.
Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund, kritisiert, dass die Festlegung der Bodenrichtwerte nicht überprüfbar sei. „Die Bodenrichtwerte sind nicht justiziabel. Da sitzt ein Gutachterausschuss, legt die Werte einfach fest und die bestimmen dann die Steuerhöhe“, sagt er in einem Interview mit dem MDR. „Das ist in einer Bananenrepublik möglich, aber nicht in einem Rechtsstaat.“ Von willkürlichem Festlegen kann jedoch keine Rede sein, denn die Gutachter legen den Bodenrichtwert anhand der realen Verkaufspreise von Grundstücken fest. Trotzdem strebt der Verband derzeit eine Musterklage gegen die Ausgestaltung der neuen Grundsteuer an.
Nicht zuletzt stehen auch die knappen Fristen in der Kritik. Eigentümer hätten lediglich vier Wochen Zeit, um Einspruch gegen den Grundwertsteuerbescheid ihres Finanzamts einzulegen. Das ist aber auch bei jeder anderen Art von Steuererklärung so und nichts Neues. Sinnvoll ist ein Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid nur in begründeten Fällen, zum Beispiel wenn falsche Daten zur Grundstücksart oder zur Wohnfläche gemacht wurden. Trotzdem raten die Lobbyverbände Haus & Grund sowie BdSt grundsätzlich zum Einspruch, auch um damit ihre eigenen Klagen zu stützen. Der Aufruf zieht: Laut dem Portal Finanztip gab es bis Anfang Februar 2023 bereits 350.000 Einsprüche gegen versendete Bescheide zum Grundsteuerwert.
Der Bodenrichtwert bildet in den meisten Bundesländern die Grundlage der Grundsteuerreform. Nur Bayern und Hamburg ermitteln die Grundsteuer künftig ohne Bodenrichtwert. Hier haben Immobilienbesitzer deshalb auch noch bis Ende April dafür Zeit, um ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Unterm Strich soll es durch die Reform für Eigentümerinnen und Eigentümer nicht teurer werden, sondern „möglichst aufkommensneutral“, wie es auf der Webseite des Bundesfinanzministerium heißt. Aber eben auch: „Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich die Höhe der Grundsteuer jedoch ändern.“ Das betrifft auch Mieter, denn Vermieter dürfen die Steuer in voller Höhe auf sie umlegen.
Wer wie viel mehr bezahlen muss, kann derzeit noch niemand valide sagen. Erst wenn die Gemeinden 2024 ihren Hebesatz auf die Werte anwenden, liegen die finalen Grundsteuerbeträge vor.