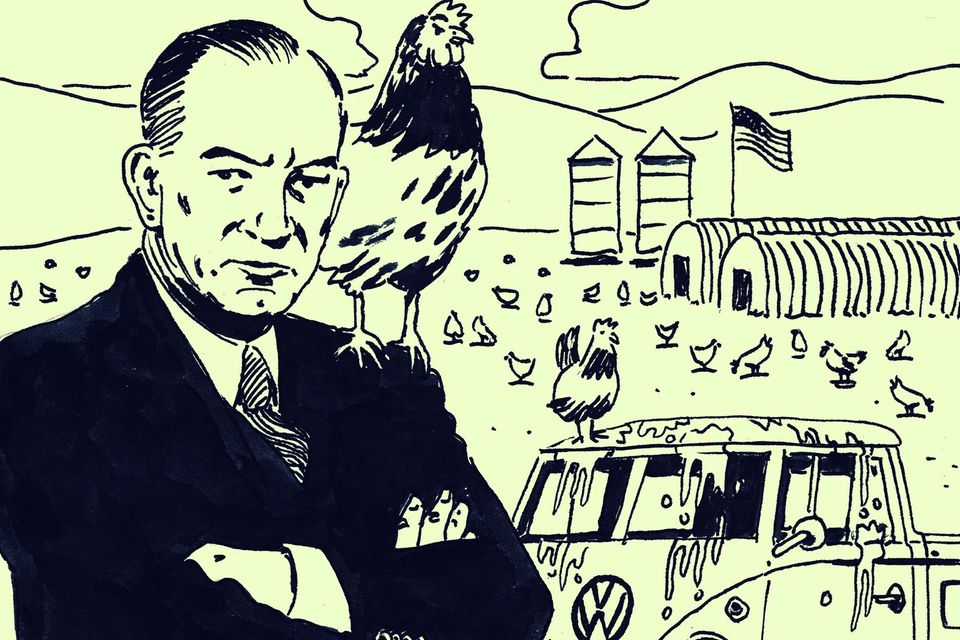Ökonomen staunten nicht schlecht, als Indien vor etwas mehr als einem Jahr seine neuesten Wachstumszahlen verkündete: Die indische Wirtschaft war nach Auskunft des Ministeriums für Statistik von einem Quartal auf das andere um zwei Prozentpunkte gewachsen. Damit löste das Land China als am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt ab. Der rasante Anstieg ließ sich mit der Umstellung auf eine neue Berechnungsmethode für das Wirtschaftswachstum erklären: Zum einen änderten die Statistiker die Berechnungsgrundlage, zum anderen zogen sie Marktpreise von Gütern und Dienstleistungen anstatt der Produktionskosten der Firmen zur Ermittlung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) heran. Volkswirtschaftler hielten die Zahlen für geschönt.
Auch ein Jahr später ist die Skepsis bei Ökonomen noch groß: Statt wie offiziell erklärt bei 7,4 Prozent dürfte das Wachstum Indiens in diesem Jahr realistisch betrachtet bei rund fünf Prozent liegen, schätzt etwa der Wirtschaftswissenschaftler Rajiv Kumar. Die aktuellen Daten zur Kreditvergabe, zum Export, zum Binnenkonsum und zur Arbeitslosigkeit seien mit einem derart rasanten Wachstum nicht in Einklang zu bringen. So wie an Indiens Wachstumszahlen zweifeln viele Beobachter bereits seit Jahren an den offiziellen Wirtschaftsdaten aus China: Unter westlichen Ökonomen, Investoren und Politikern gehört es quasi zum guten Ton, Zahlen aus China in Frage zu stellen.
Ist das BIP noch angemessen?
Das Misstrauen in die Wachstumszahlen ist berechtigt, sagt Lutz Karpowitz, Ökonom und Währungsexperte der Commerzbank: „Die technische Entwicklung des Statistikwesens in Schwellenländern ist nicht vergleichbar mit der in entwickelten Industriestaaten.“ Vor allem in China liege zudem der Verdacht nah, dass die Regierungspartei die Wachstumszahlen zumindest glätte: „Das chinesische Statistikamt kann nicht unabhängig agieren.“ Die Konjunkturdaten anderer Schwellenländer seien noch kritischer zu betrachten: „Aus Argentinien oder Venezuela erhält man kaum verlässliche Zahlen – und wenn, sind sie höchstwahrscheinlich manipuliert.“
Viele Ökonomen stellen inzwischen die Frage, ob der Blick auf die Veränderung des BIP zur Ermittlung des Wirtschaftswachstums eines Landes überhaupt noch angemessen ist. „Wachstumszahlen stellen letztlich nur eine Facette des wirtschaftlichen Wohlbefindens eines Landes dar“, sagt etwa Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka. Das BIP als wichtigster Gradmesser für wirtschaftliche Leistung und Wohlstand steht schon seit Jahren in der Kritik. Es misst den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb einer bestimmten Periode in einer Volkswirtschaft hergestellt werden. Größen wie Lebenszufriedenheit, Gesundheit oder Kosten von Umweltschäden erfasst das BIP aber nicht. „Anleger sollten sich grundsätzlich immer unterschiedliche Konjunkturdaten anschauen und weitere Informationen über die Situation eines Landes einholen, um den Zustand einer Volkswirtschaft zu bewerten“, sagt Kater. Wer nur auf die offiziellen Angaben zum BIP-Wachstum achte, denke zu kurz.
Zweifel am Li-Keqiang-Index
Selbst am Nutzen vermeintlich präziser Instrumente zur Wachstumsmessung der chinesischen Wirtschaft zweifeln Volkswirtschaftler mittlerweile: So fasst in China der sogenannte Li-Keqiang-Index seit mittlerweile neun Jahren den Energieverbrauch, die Kreditvergaben und die Eisenbahnfrachttonnen zusammen um das Wachstum des Landes genauer abzubilden. „Die Zeiten, in denen Stromverbrauch, Gütertransport und die Vergabe von privaten Krediten die maßgeblichen Wachstumsparameter waren, sind allerdings vorbei“, kritisiert Andy Rothman, Investmentstratege beim Fondsanbieter Matthews Asia. Den Li-Keqiang-Index als Wachstumsindikator zu nutzen sei in etwa so sinnvoll, als würde man den Zustand der US-Wirtschaft nach dem Verkauf von Blackberry-Smartphones beurteilen, ätzt Rothman.
Das liege an der Umstrukturierung der chinesischen Wirtschaft. In China werde das Wachstum stärker vom Binnenkonsum angetrieben als von energieintensiven Schwerindustrien. Auch Dienstleistungen spielen in der chinesischen Wirtschaft wie in vielen anderen Volkswirtschaften eine immer größere Rolle. „Die Struktur der chinesischen Ökonomie hat sich im vergangenen Jahrzehnt so sehr verändert, dass wir die Art und Weise, wie wir Wachstum messen, ändern müssen", sagt Rothman. Erst dann würden die Konjunkturdaten aus China verlässlich und hätten wieder eine größere Aussagekraft für die reale Wirtschaftsentwicklung des Landes.