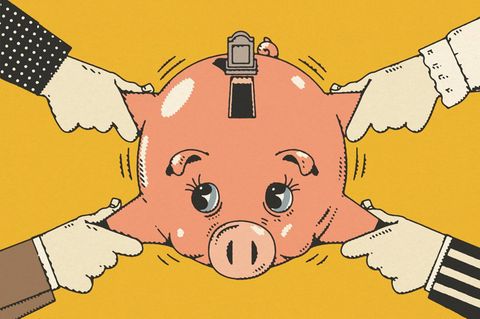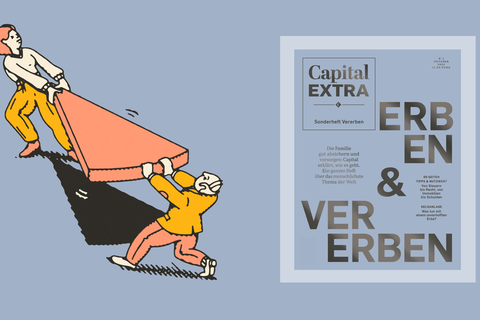Die Europäische Zentralbank stellt Banken inzwischen auch Geld zu Negativzinsen zur Verfügung, sofern sie es nutzen, um die Kreditvergabe auszuweiten. Gibt es bald Geld dafür, einen Konsumenten- oder Immobilienkredit aufzunehmen?
Das ist unwahrscheinlich, da die Zinskosten nur einen – inzwischen sehr kleinen - Teil in der Kalkulation ausmachen, welche Zinsen Banken den Kreditnehmern berechnen. Personal, Marketing und Vertrieb und die Risikoaufschläge für drohende Ausfälle kosten ebenfalls. Geld gab es bislang auch schon fast zum Nulltarif für Banken. Über die immer niedrigeren Renditen von Staatsanleihen sowie die Negativzinsen für Einlagen bei der EZB geraten die Margen der Banken zudem immer stärker unter Druck, so dass die tieferen Zinsen auch eine Verteuerung der Kredite beim Endkunden zur Folge haben könnten - dieser Effekt ließ sich etwa in der Schweiz bei Immobilienkrediten beobachten.
Für Übernachteinlagen bei der EZB verlangt die Notenbank inzwischen 0,4 Prozent Strafzinsen. Drohen die bald auch den Sparern?
Das ist nicht ausgeschlossen, aber ebenfalls wenig wahrscheinlich für die typischen Spar- und Girokonten mit maximal sechsstelligen Beträgen. Zwar müssen die Banken dieses Guthaben derzeit subventionieren. Ihr Geschäftsmodell mit Spar- und Girokonten fußt aber auch nicht nur darauf, mit den Einlagen Zinsgewinne zu erwirtschaften, sondern ist eine Mischkalkulation: Wer bei einem Institut ein Girokonto, ein Sparbuch oder gar beides führt, ist eher geneigt, dort auch andere weitaus margenstärkere Geschäfte abzuschließen. Dazu zählt etwa, einen Immobilienkredit aufzunehmen oder das Geld in rentablere, aber auch provisionsintensive Anlageformen zu überführen wie Bausparverträge und Investmentfonds. Naheliegender wäre daher, die Erlöse über höhere Gebühren zu steigern.
Zudem sind Strafzinsen auch verhaltensökonomisch ein unbekanntes Terrain: Es ist keinesfalls sicher, dass immer tiefere Negativzinsen die Menschen zu mehr Konsum oder Investitionen verleiten. Womöglich weiten sie das Angstsparen aus oder lassen sich Guthaben in bar auszahlen. Denn Strafzinsen können einen starken psychologischen Effekt haben, wenn Sparer das Gefühl bekommen, ihnen wird etwas weggenommen, können sie dem entgegen wirken wollen.
Bargeld in eigenen Tresor horten
Apropos Barauszahlungen: Warum trägt eine Bank die Einlagen der Kunden überhaupt zur EZB, wenn diese 0,4 Prozent Strafzinsen verlangt? Sie kann das Geld doch genauso gut selbst in bar halten oder sich Guthaben von der EZB in bar auszahlen lassen.
Tatsächlich ist Bargeld der Grund, warum weder die Europäische Zentralbank von den Geschäftsbanken noch die Banken von Sparern immer stärker negative Einlagenzinsen verlangen können. Ab einem gewissen Punkt lohnt es sich für einen Sparer, sein Guthaben lieber in Scheinen unter dem Kopfkissen oder einem Bankschließfach zu verwahren, als es zur Bank zu tragen. Auch eine Geschäftsbank kann von der Zentralbank jederzeit die Auszahlung von Guthaben in Bargeld verlangen und es in Tresoren einlagern.
Aber ist das nicht allenfalls ein theoretisches Modell?
Mitnichten. Der bayerische Sparkassenverband hat etwa Anfang März per Rundschreiben an seine Mitgliedsbanken unverhohlen Werbung dafür gemacht, Geld lieber im eigenen Tresor zu bunkern, anstatt es bei der EZB langsam schmelzen zu lassen. Ab einem gewissen Punkt sind die Kosten für die Bargeldlagerung geringer als für eine Einlage bei der EZB.
Okay, und wo liegt dieser Punkt bei den Banken?
Analysten von Goldman Sachs haben 2014 näherungsweise berechnet, ab wann sich für Banken die Auslieferung, Einlagerung, Bewachung und Versicherung von Cash lohnt. Sie sind dabei auf einen Wert von rund minus 1,4 Prozent für Guthaben von 10 Mrd. Euro gekommen und, aufgrund von Skaleneffekten, von minus 0,5 Prozent für 100 Mrd. Euro.
Wieso so viel?
Weil es vor allem eine logistische Herausforderung wäre. Die Deutsche Bank etwa weist derzeit Liquidität und Liquiditätsreserven von insgesamt rund 220 Mrd. Euro auf. Unterstellen wir, dass sie alle Reserven ziehen und sich diese Liquidität komplett in bar in 200-Euro-Scheinen auszahlen lassen würde (der 500-Euro-Schein ist schließlich bald Geschichte), entspräche dies rund 1600 Kubikmetern Geld. Das ist das typische Fassungsvermögen eines Hallenbad-Beckens. Für die im Alltag gebräuchlicheren kleinen Scheine würde sich der Aufwand entsprechend vervielfachen.
Drei Kubikmeter für 1 Mrd. Euro
Wie sieht die Rechnung für Sparer aus?
Anders als für Großbanken ist die Einlagerung von Bargeld auch nach der geplanten Abschaffung der 500-Euro-Banknoten kein logistisches Problem: 100.000 Euro wiegen in 200er-Scheinen nicht einmal ein Kilogramm, selbst 1 Mio. Euro passt in ein kompaktes Schließfach von der Größe eines Schuhkartons, das Banken zu Jahresmieten von 50 bis 100 Euro anbieten.
Komplizierter wird es beim Thema Versicherung: Bargeld ist in Bankschließfächern häufig gar nicht oder nur im Rahmen bestimmter Höchstgrenzen im maximal fünfstelligen Bereich versichert. Individuelle Tresorinhaltsversicherungen und Bargeldalternativen – etwa auf mündelsichere Wertpapiere oder Edelmetalle – kosten zusätzlich. Anders als bei Banken klettern die Opportunitätskosten aufgrund des begrenzten Versicherungsschutzes mit höheren Bargeldsummen.
Wollen Politik und Notenbanken den 500-Euro-Schein abschaffen, um das Horten von Bargeld zu erschweren?
Man muss schon naiv sein, um zu glauben, dass es der EZB bei der Abschaffung nur um die Schwarzgeldbekämpfung und nicht auch um die langfristige Effektivität ihrer Geldpolitik geht. Zuletzt waren 500-Euro-Scheine im Wert von rund 307 Mrd. Euro im Umlauf. Das sind knapp 40 Prozent der Summe aller umlaufenden Banknoten und unterstreicht die Rolle des Scheins im Bargeldsystem, selbst wenn er im Alltag der meisten Bürger keine Rolle spielt.
Dass der 500-Euro-Schein populär ist, um größere Barsummen vorzuhalten, hat noch einen weiteren, einfachen Grund: Mit keiner Währung lässt sich bislang derart platzsparend Bargeld aufheben wie mit großen Euro-Scheinen. Allenfalls der unbedeutendere Schweizer Franken kommt da noch heran. Der Euro hat den geringsten Platzbedarf aller großen Währungen, was sich an der Aufbewahrung von 1 Mrd. Euro zeigen lässt. Für US-Dollar – mit dem 100-Dollar-Schein als größte Note – benötigt man dafür zwölf Kubikmeter, für japanische Yen mindestens 16 Kubikmeter, für das britische Pfund mindestens 21 Kubikmeter. Dagegen würde für den Euro mit 500-Euro-Scheinen aber nur drei Kubikmeter benötigt. Die Abschaffung des „Fünfhunderters“ erhöht die Opportunitätskosten für die Bargeldhaltung deutlich – und damit auch die Wirkmächtigkeit negativer Einlagenzinsen.
Wird fortgesetzt!