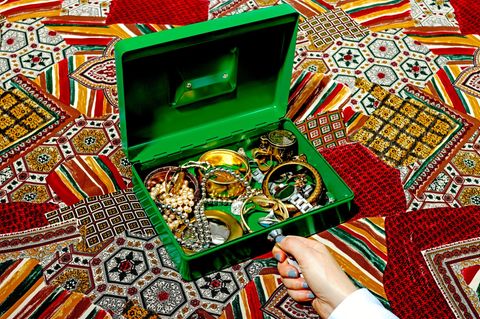Donald Trump hat einen neuen Feind ausgemacht: die Notenbanken in China und der Eurozone. Sie manipulierten ihre Währungen und schadeten damit den Vereinigten Staaten, zürnte der US-Präsident vergangene Woche auf Twitter. Sein Vorwurf: Dadurch, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und andere Notenbanken die Leitzinsen – anders als die Fed – weiter niedrig halten, schwächen sie ihre Währungen. Der US-Dollar hingegen steigt und steigt, im Windschatten der US-Leitzinsen. Ein starker Dollar bedeute für die Vereinigten Staaten einen Wettbewerbsnachteil, klagte Trump. Er deutete sogar an, sich in die Geldpolitik der Fed einmischen zu wollen, obwohl die US-Notenbank formell unabhängig ist. Zusätzlich zum Handels- droht nun womöglich ein Währungskrieg.
Ganz aus der Luft gegriffen sind die Anschuldigungen des US-Präsidenten nicht. Die Geldpolitik in den USA und in der Eurozone driftet tatsächlich auseinander. Mitte kommenden Jahres dürfte die Differenz zwischen den Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks bei rund 3,5 Prozent liegen, prognostiziert Bantleon-Chefvolkswirt Daniel Hartmann. Das wäre ein neuer Rekordwert. „Damit steigt die Wahrscheinlichkeit heftiger Wechselkursschwankungen“, sagt Hartmann.
Für die divergierende Geldpolitik gibt es allerdings gute Gründe. In den USA läuft die Wirtschaft nicht zuletzt dank Trumps Steuerreform auf vollen Touren, in Europa sieht es dagegen eher mau aus. Während geldpolitische Stimuli in der Eurozone nach Ansicht vieler Ökonomen durchaus noch berechtigt sind, bleibt der Fed nicht viel anderes übrig, als die Leitzinsen anzuheben. Die Wirtschaft könnte andernfalls überhitzen, die Inflation massiv steigen.
Euro-Schwäche kein Grund zum Jubeln für Anleger
An der bösen Absicht, die Trump der EZB unterstellt, dürfte also nichts dran sein. Die Euro-Schwäche des laufenden Jahres sei eine Begleiterscheinung der EZB-Politik, nicht ihr Ziel. Von einer Währungsmanipulation könne mithin nicht die Rede sein, sagen Volkswirte. Hinzu kommt: Das schwache Euro ist für europäische Anleger nicht gerade ein Grund zum Jubeln.
Üblicherweise freuen sich Investoren über eine schwache heimische Währung. „Ein Wertverlust des Euros lässt im Ausland erzielte Erträge bei der Umrechnung in die Heimatwährung wie von Zauberhand wachsen“, erklärt Marc-Oliver Lux, Chef der Münchner Vermögensverwaltung Dr. Lux & Präuner. Von diesem Effekt profitieren vor allem internationale Konzerne, die einen Gutteil ihrer Umsätze im Ausland erzielen. Ihre Aktienkurse steigen, Anleger können Kursgewinne vereinnahmen.
Zuletzt sei diese Gesetzmäßigkeit allerdings kaum zu beobachten gewesen, sagt Lux. Für einen Euro bekommen Anleger mittlerweile nur noch rund 1,17 US-Dollar. Anfang des Jahres stand der Wechselkurs noch bei 1,25 Dollar je Euro. Der deutsche Aktienindex Dax hat auf diese Entwicklung längst nicht so stark reagiert wie erwartet. „Mittlerweile sehen Profis in der Euro-Schwäche vor allem ein Warnsignal“, sagt Lux.
source: tradingeconomics.com
Italien belastet den Euro-Kurs
Nach Einschätzung des Vermögensverwalters ist die Schwäche der europäischen Gemeinschaftswährung zum Gutteil auf politische Turbulenzen zurückzuführen – vor allem auf die neue Regierung in Italien, die sich Euro-kritisch gibt und auf Konfrontationskurs zur EZB geht. „Sollte die drittgrößte Ökonomie aus dem Euro austreten, wäre das der Anfang vom Ende der Gemeinschaftswährung“, warnt Lux. Die Folgen dürften sinkende Ausfuhren und Unternehmensgewinne sein, schrumpfende Löhne und niedrigere Konsumausgaben. „Dieses Risiko preisen die Akteure an den Aktienmärkten stärker ein als vorübergehende Wechselkursprofite in den Bilanzen der deutschen Blue Chips“, urteilt der Anlageprofi.
Weder ein Auseinanderbrechen des Euro-Raumes noch ein Währungskrieg zwischen Europa und den USA sind ausgemachte Sache. Klar ist aber: Die Währungsmärkte reagieren mittlerweile sehr sensibel auf politische Geschehnisse. „Nicht jede kleine Zuckung der Devisenkurse muss einen beunruhigen“, sagt Lux. Anleger sollten größere Wechselkursverwerfungen allerdings zum Anlass nehmen, die Lage an den Finanzmärkten neu unter die Lupe zu nehmen.