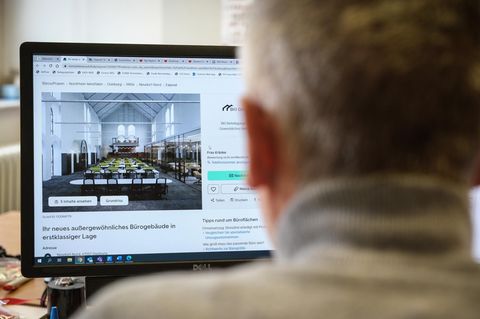Jeden Tag ein weiterer Rekord, der nächste Höchststand, ein Allzeithoch. Egal, ob bei Aktien, Gold oder Bitcoin – es scheint nur noch aufwärts gehen zu können. Am Mittwochmorgen sprang der wichtigste deutsche Aktienindex tatsächlich kurzzeitig über die Schwelle von 18.000 Punkten. Zwar drehte er dann vorerst wieder nach unten. Doch vor zwei Monaten schienen solche Kurse unvorstellbar.
Es ist ein merkwürdiger Mix, der die Kurse gerade treibt: gute Daten aus einzelnen Branchen und Wirtschaftsbereichen (alles mit Künstlicher Intelligenz zum Beispiel), halbwegs ordentliche Wirtschaftsdaten aus den meisten Industrienationen (bis auf Deutschland und China vielleicht), die Hoffnung auf bald sinkende Leitzinsen und ein paar Spezialthemen bei Gold und Krypto. Doch ebenso hitzig wie die möglichen Ursachen der aktuellen Marktrallye werden ihre Absturzrisiken diskutiert – jene Faktoren, die die Rekordjagd jäh beenden und ins Gegenteil verkehren könnten.
Denn die Logik an der Börse erscheint simpel: Je höher der Aufstieg, desto tiefer auch der drohende Fall. So zumindest eine verbreitete Sorge vieler Anleger. Daher ordnet Capital einmal die fünf großen Gefahren für die Märkte ein, die heute schon bekannt sind – inklusive auch jenem Risiko, das heute noch niemand so genau kennt, aber von dem alle wissen, dass es existiert.
#1 Die Höchststände selbst
Oft werden in diesen Wochen Vergleiche zur großen Blase am japanischen Aktien- und Immobilienmarkt gezogen, die 1989 abrupt platzte, oder zum Dotcom-Crash im Frühjahr 2000. Und tatsächlich gibt es einige Parallelen: So hat der japanische Nikkei-Index erst vor wenigen Tagen seinen damaligen – und fast 35 Jahre nicht mehr erreichten – Höchststand von fast 39.000 Punkten übertroffen. Der Nasdaq 100, der Index für die wichtigsten US-Tech-Werte, steht bei mehr als 18.200 Punkten – mehr als viermal höher als im Jahr 2000. Und immer noch fast 2000 Punkte höher als auf dem Höhepunkt des „Alles-läuft-jetzt-digital-Booms“ in der Coronapandemie. Allein das Plus seit Ende Oktober beträgt fast 25 Prozent.
Die Frage also, wie lange das noch so weitergehen kann, liegt ziemlich nahe. Doch was ist dran an dieser Frage?
Wer sich Kursverläufe über einen langen Zeitverlauf anschaut, achtet meist als erstes auf die heftigen Ausschläge – vor allem auf die nach unten. Es stimmt schon, durch den anschließenden Einbruch wirken Höchststände davor meist etwas größenwahnsinnig. Doch man übersieht dabei oft die langen Phasen davor, in denen es beständig aufwärts ging. So erlebten etwa die US-Börsen seit der großen Finanzkrise Ende 2008 einen mehr oder weniger kontinuierlichen Anstieg – bis zum Einbruch Ende 2021. Bedeutet: Aus der langen Folge neuer Höchststände folgt weniger die steigende Gefahr des Einbruchs als vielmehr die Aussicht, dass es wahrscheinlich auch noch eine Weile so weitergehen kann.
Ein zweiter Faktor kommt hinzu, der beim Blick auf die Rekordstände schnell aus dem Blick gerät: Es ist ja gar nicht so, dass alle Aktien gerade übermäßig gut laufen. Das Bild ist stattdessen sehr viel differenzierter: Tech-Unternehmen, die sehr offensiv mit neuen Produkten und Lösungen auf der Basis künstlicher Intelligenz aufwarten können, eilen davon – das betrifft etwa Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und natürlich der KI-Profiteur schlechthin, der Chiphersteller Nvidia. Andere Tech-Unternehmen, die bisher kaum oder gar nicht mit KI aufgefallen sind, liegen dagegen zurück, etwa der iPhone-Hersteller Apple oder der Autobauer Tesla. Selbst die „Magnificent Seven“, die im vergangenen Jahr die US-Börsen antrieben, fallen gerade auseinander.
Und die Aktien von jenen Unternehmen, die bereits erfolgreich KI-Anwendungen anbieten, wie Microsoft zum Beispiel, erreichen zwar hohe Kurse, die aber in Relation zum Gewinn nicht übertrieben erscheinen: Bei einem Kurs von 415 Dollar kommt Microsoft gerade auf ein KGV von gut 34 (auf der Basis des erwarteten Gewinns für das laufende Geschäftsjahr) – das ist historisch nicht außergewöhnlich. Beim Chiphersteller Nvidia ist das KGV sogar dramatisch gefallen, trotz des explodierten Aktienkurses von derzeit 920 Dollar – weil eben auch der Gewinn des Unternehmens durch die Decke geht.
Kurzum: Ja, die Kurse sind ganz schön hoch. Ein Automatismus, dass sie allein deshalb schon bald fallen müssen, folgt daraus jedoch nicht.
#2 Die nächste Zinswende
Bei den Risiken für die aktuellen Bewertungen muss man zwei davon grundsätzlich auseinanderhalten: bekannte Risiken und unbekannte Risiken. Die bekannten Risiken sind da, sie werden jederzeit beobachtet, analysiert, abgeschätzt und von den professionellen Investoren tagtäglich in ihren Portfolios neu justiert. Allerdings folgt daraus: Die Märkte bilden diese Risiken eigentlich auch immer ganz gut ab.
In diese Kategorie fällt die (enttäuschte) Hoffnung auf schnell sinkende Zinsen. Ja, es spricht derzeit viel dafür, dass die Notenbanken in den USA und in Europa noch in diesem Jahr die Zinsen senken werden, wahrscheinlich aber etwas später, als von vielen Investoren noch vor drei oder vier Monaten erwartet. Aktuell gehen viele Beobachter davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed im Juni so weit sein könnten, vielleicht aber auch erst einige Wochen später.
Man hätte erwarten können, dass allein diese Verschiebung der Zinssenkung zu einer gewissen Verunsicherung an den Börsen führt. Hat es aber nicht, im Gegenteil. Etwa auch deshalb, weil die weiterhin hohen US-Zinsen zugleich ein Zeichen für die Robustheit insbesondere der US-Wirtschaft sind – es gibt dort im Moment sogar streng genommen wenig Grund, die Zinsen zu senken.
Wie auch immer nun die Sache mit den Zinsen weitergeht, die Märkte werden jedes Komma und jeden Halbsatz von EZB-Chefin Christine Lagarde und Fed-Chef Jerome Powell im Handumdrehen durchdenken. Die aktuellen Höchststände bilden dieses Wissen ziemlich gut ab.
#3 Etliche andere Makro-Risiken
Das wichtigste Risiko für die Notenbanken ist eine unvorhergesehene Rückkehr der Inflation. Im Vergleich zur Lage vor gut einem Jahr sind die Teuerungsraten deutlich zurückgegangen: In Europa lagen die Preise zuletzt nur noch um 2,6 Prozent höher als vor einem Jahr, in Deutschland betrug die Rate 2,5 Prozent. Im Frühjahr 2023 hatte die Inflationsrate noch bei 6 bis 7 Prozent gelegen.
Ähnlich ist das Bild in den USA, auch wenn dort die Inflation ganz aktuell noch etwas hartnäckiger scheint: So beschleunigte sich der Preisauftrieb im Februar sogar wieder leicht und liegt mit aktuell 3,2 Prozent deutlich über den europäischen Werten. Allerdings: Alles kein Vergleich mehr zu Werten von vor einem Jahr, als die Inflationsrate auch dort noch bei um die 6 Prozent gelegen hatte.
Schaut man nur auf die Zahlen, so ist das Potenzial für Zinssenkungen in der Eurozone sogar etwas höher als in den USA – da hierzulande auch die Wirtschaft deutlich schwächer läuft.
Risiken für die Bewertungen an den Aktienmärkten könnten also vor allem entstehen, wenn die Inflationsrate oder die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten deutlich anders verlaufen als derzeit gedacht: Für die USA haben die Märkte inzwischen relativ klar ein so genanntes „soft landing“ eingepreist, also eine glückliche Lage, in der die Wirtschaft trotz massiver Zinsanhebungen einfach robust weiterläuft. Die Mehrheit rechnet derzeit offenbar mit einem „goldilocks“- oder „Goldlöckchen“-Szenario: Die Weltwirtschaft läuft eigentlich ganz gut, die Zinsen sind nicht übermäßig hoch und könnten tendenziell sogar etwas sinken. Zugegeben, dagegen stehen erheblich Zweifel (siehe Punkt 5), aber es muss ja auch nicht immer alles ganz schlimm kommen.
Sollten an dieser Version jedoch – jenseits großer Schocks von außen – Zweifel aufkommen, etwa durch schlechtere Daten vom US-Arbeitsmarkt oder vom Konsum, so hätte sicher auch das Auswirkungen auf die Märkte. Wahrscheinlich würden dann auch die Zinsen schneller sinken – was in dieser Lage aber wohl nicht mehr als Signal der Stärke, sondern als Zeichen der Schwäche und Unsicherheit gewertet würde. Mit diesem Szenario rechnet etwa der Vermögensverwalter Feri aus Bad Homburg: „In den USA ist im zweiten Halbjahr eine Konjunkturschwäche plausibel“, sagt Feri-Chefanlagestratege Marcel Lähn. „Die Aktienmärkte spielen im Moment das Thema Sorglosigkeit. Aber die Wirkung der restriktiven Geldpolitik in der Realwirtschaft wird dann zunehmend sichtbar.“
Feri rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent mit einer Rezession in den USA und einem „Kipppunkt am Arbeitsmarkt im zweiten Halbjahr“. Die Folgen wären massive Zinssenkungen der Fed, die Aktienmärkte kämen unter Druck und die Rentenmärkte könnten zulegen. Das Risiko eines Wiederanstiegs der Inflation beziffert Feri-Chefvolkswirt Axel Angermann hingegen nur mit 20 Prozent. Ein Auslöser könnte eine Eskalation der zahlreichen Konflikte im Nahen und Mittleren Osten sein, mit neuen Störungen in den globalen Lieferketten oder einem deutlichen Rückgang des Öl-Angebots (siehe Punkt 5, geopolitische Risiken).
#4 Gold und Bitcoin
Ein Bitcoin kostet inzwischen fast 67.000 Euro, seit Oktober hat sich der Kurs nahezu verdreifacht. Nicht ganz so spektakulär, aber dennoch eindrucksvoll ist der Anstieg des Goldpreises, er kletterte in diesem Zeitraum um mehr als zehn Prozent und liegt inzwischen bei fast 2000 Euro je Feinunze.
Diese Preisanstiege sind erstaunlich, die Gründe aber auch äußerst individuell. Erstaunlich deshalb, weil die Flut des ultrabilligen Geldes durch die Notenbanken nun schon lange vorbei ist – in der Vergangenheit immer ein beliebtes Argument für die steigenden Kurse – und zumindest professionelle Anleger aktuell mehr auf die risikofreien Alternativen achten dürften. Denn die gibt es ja wieder: Anleihen mit guter Bonität rentieren immer noch mit 3 bis 4 Prozent, in den USA sogar mit 5 bis 6 Prozent.
Als Gründe für den Anstieg des Bitcoin werden vor allem die Einführung sogenannter Bitcoin-ETFs in den USA genannt, die den Kryptohandel deutlich vereinfachen, zugleich aber die Nachfrage nach Bitcoins anheizen. Und hinzu kommt ein Ereignis, das vor allem Krypto-Jünger umtreibt und durchdringen: das so genannte Halving. Dabei wird die Belohnung halbiert, die all jene Miner erhalten, die mit ihren Rechenkapazitäten an der Bitcoin-Blockchain arbeiten: von aktuell 6,25 Bitcoin je errechnetem neuen Block auf dann noch 3,125 Bitcoin. So gelangen immer weniger neue Bitcoin in den Markt und das Angebot wird perspektivisch knapper.
Beim Goldpreis wiederum gelten die Notenbanken und nicht etwa überbesorgte Privatkunden derzeit als Hauptpreistreiber. Sie stockten gerade deutlich ihre Bestände auf, um ihre Reserven zu diversifizieren, heißt es.
So oder so bleibt jedoch die Frage: Könnte eine Preiskorrektur bei Gold oder Bitcoin auch andere Märkte anstecken? Und die Antwort lautet: eher nein. Denn die Märkte sind doch so voneinander separiert, dass sich keine automatischen Ansteckungsgefahren ergeben. Das gilt insbesondere für Bitcoin als Spekulationsobjekt, dessen wahrer Wert anders als bei Aktien nicht wirklich objektiv zu ermessen ist. Heftige Einbrüche und Ausschläge beim Bitcoin etwa hat es in den letzten 15 Jahren immer wieder gegeben – der Effekt auf Aktienkurse im Guten wie im Schlechten war jeweils: nicht erkennbar.
#5 Die Geopolitik – das unbekannte Risiko
Von allen Risiken, die die aktuelle Rallye an den Märkten bedrohen, ist die Geopolitik wohl das Feld, das am schwierigsten zu kalkulieren ist. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen, die Angriffe der Huthis auf Handelsschiffe im Roten Meer, das Tauziehen Irans mit den USA, schließlich der drohende Konflikt zwischen China und Taiwan: Die Welt hat wahrlich momentan genug Krisenherde, die jederzeit eskalieren und auch die Weltwirtschaft treffen können – sei es beim Angebot mit Öl und Gas, sei es bei der Versorgung mit Mikrochips oder bei der generellen Sicherheit von Lieferketten.
Das hätte dann unweigerlich auch Folgen für die Inflation und die Notenbanken. „Die Inflation könnte beispielsweise wieder ansteigen, wenn der Ölpreis bei einer geopolitischen Krise hochschießt“, sagt Feri Chefvolkswirt Axel Angermann. Ganz auszuschließen sei das nicht. „Die Gemengelage im Nahen Osten besitzt ein hohes Eskalationspotenzial.“ In diesem Fall würden Zinssenkungen der Fed als Politikfehler gewertet, die Kurse von Aktien und Anleihen gerieten wie im Jahr 2022 gemeinsam unter Druck.
So offensichtlich diese Risiken sind, so schwer sind sie doch für Investoren zu kalkulieren. Sicher ist an ihnen eigentlich nur, dass sie existieren – ob sie eintreten und wenn ja, in welchem Ausmaß, ist offen. Das Risiko, dass die Märkte übrigens derzeit am wenigsten auf dem Schirm haben dürften, ist wahrscheinlich Iran: Sicherheitsexperten rechnen damit, dass das Land kurz davorsteht, eine eigene Atombombe bauen zu können. Nicht, dass die Mullahs in Teheran diese dann auch gleich einsetzen würden. Aber allein die Erklärung, dass das Land nun im Besitz dieser Fähigkeit ist (und womöglich auch ein Test als Beweis), wäre ein Schock für die Welt und die Sicherheitslage in der gesamten Region.
Kann man sich darauf als Anleger sinnvoll vorbereiten? Ja, durch eine möglichst breite Diversifizierung über alle Anlageklassen und Regionen – genau der Ansatz also, den auch professionelle Anlageberater und gute Ratgeber wie Capital ohnehin immer geben. Und, zweiter Rat: Bloß nicht aus Sorge vor einem Crash schon vorauseilend aus dem Markt zurückziehen! Denn jenseits der Geopolitik spricht vieles dafür, dass die gute Lage an den Aktienmärkten noch einige Zeit anhalten kann.