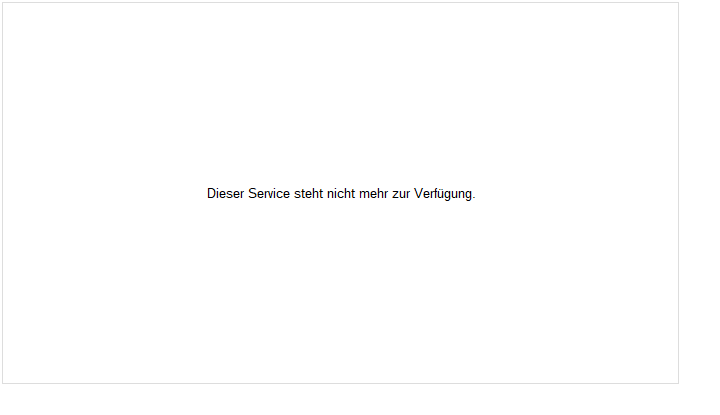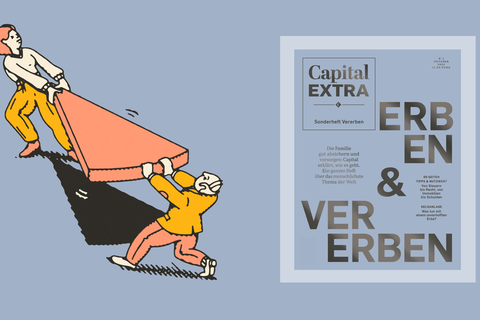Am Donnerstag flatterten die Nerven der Börsianer hierzulande gehörig. An jenem Tag nämlich, an dem die EZB zusammentrat, um in ihrer jüngsten Sitzung die weitere Strategie zu verkünden. Die Nervosität der Aktienkäufer kann man gut am Kurs des Dax ablesen: Er zuckte im Zweihundertpunkteband wild seitwärts und fiel zeitweise auf 12.300 Punkte ab. Bis die Botschaft der Europäischen Zentralbank kam: Sie pumpt noch mehr Geld in die Märkte und wird weiter Anleihen aufkaufen. Soweit hatte der Markt das auch erhofft, ja vielleicht sogar erwartet. Doch de EZB legte auf das Erwartete sogar noch eine Schippe drauf: Für weitere 600 Mrd. Euro will sie nun weitere Anleihen aufkaufen. Zusätzlich zu den bereits geplanten 750 Milliarden, die sie bereits als Coronahilfen zugesagt hatte. Zuvor waren Marktbeobachter von nur 500 weiteren Mrd. Euro ausgegangen. Damit schnürt die Notenbank das gigantischte Konjunkturpaket, dass die europäischen Börsen bisher gesehen haben. In der Folge stürmten die Käufer den Markt.
Am Freitagmorgen startet der deutsche Leitindex Dax mit sagenhaften 12.700 Punkten in den Handelstag. Ein paar Zähler gab er zwar auch rasch wieder ab, aber der Optimismus der Börsianer ist unübersehbar. Sie decken sich mit Aktien ein. Auch weil die Bundesregierung ebenfalls ein weiteres Konjunkturpaket aufgelegt hat, das der notleidenden Wirtschaft wieder auf die Beine helfen soll. Die Käufer treiben also die Erholung nach dem Corona-Crash weiter kräftig voran: Inzwischen notiert der Dax nur noch 10 Prozent unter seinem Vorkrisenstand. Er ist bereits wieder auf dem Niveau angekommen, das er zuletzt im Oktober hatte. Und auf Jahressicht schreibt er schon wieder ein kleines Plus von 3,83 Prozent. Auf zehn Jahre sind es immerhin schon wieder 109 Prozent Wertgewinn. Auch der amerikanische S&P steht derzeit nur noch acht Prozent unter Wasser. Die Börsen sind also schon fast wieder dabei, einen Strich unter die Krise zu ziehen.
Und interessanterweise sind es gerade die Privatanleger, die diesen Aufschwung treiben, sagen die Absatzstatistiken. Vor allem Selbstentscheider und Depotbesitzer drückten die Ordertasten in den letzten Wochen und stiegen zu Kursen ein, die ihnen günstig erschienen. Das befeuerte die Indizes enorm. Die Skepsis vieler Fondsmanager und Großinvestoren ist dagegen groß. Viele Profis sind zurzeit nur mit minimalen Aktienquoten am Markt unterwegs. Sie halten stattdessen hohe Cashbestände, teilweise von bis zu 40 Prozent. Das ist weit mehr als das Übliche. Warum? Weil sie immer noch glauben, dass ein weiterer schwerer Kursdämpfer bald bevorstehen könnte. Weil es nämlich schlichtweg nicht sein könnte, dass sich Finanzwirtschaft und Realwirtschaft so weit und so nachhaltig voneinander entkoppeln, so sagen sie.
Tech-Werte schlagen Value-Aktien
Mal unabhängig von der Frage, ob es nun den zweiten Absturz geben wird oder nicht, also die zweite Welle am Kapitalmarkt – man darf zurecht über das große Kursfeuerwerk staunen. Vor allem, wenn man sich ansieht, wer dabei in den letzten Wochen gewonnen hat: Laut einer Auswertung der Ratingagentur Morningstar zeichnet sich nämlich ein ganz klares Bild zugunsten der Wachstumswerte ab. Growth-Titel lagen weit vor den Value-Titeln bei dieser Post-Corona-Rally. Das ist nicht ganz überraschend, wenn man sich alleine ansieht, wie stark die Tech-Aktien seit März wieder zugelegt haben, die ja klassische Wachstumswerte sind.
Interessant ist aber, dass die Wachstumswerte nicht nur auf Monatssicht voranstürmen, sondern dass sie auch auf Jahressicht und Dreijahressicht deutlich besser abgeschnitten haben als die wertorientierten Value-Titel. Denn heißt es nicht immer, die Wachstumswerte würde bei einem Crash stärker gebeutelt? Sie stürzten also umso rasanter bergab, auch wenn sie sich danach oft wieder schnell erholten. Das Gegenteil war diesmal der Fall: In der Coronakrise fiel der amerikanische S&P500 um gut 30 Prozent, inzwischen erholte er sich wieder auf 90 Prozent seines Januarstands. Zerlegt man ihn nun in die Value- und Growth-Werte, so errechneten US-Analysten, dann verloren die Growth-Werte nur 25 Prozent im März. Inzwischen liegen sie wieder bei 100 Prozent, also so hoch wie im Januar. Die Value-Werte dagegen stürzten sogar um 40 Prozent ab, also tiefer als die Wachstumstitel und als der Gesamtindex. Und sie stehen heute erst wieder bei 80 Prozent ihres Januar-Werts.
Mehr noch: Das Hinterherhinken der Value-Titel lässt sich bereits seit 10 Jahren beobachten, also während des gesamten vergangenen Booms. Wann also soll nun eigentlich ihre große Stunde wieder schlagen, wenn es weder im Abschwung, noch im Aufschwung dazu kommt? Oder hat sich das Konzept gar überlebt? Vielleicht ist die Zeit der Value-Investoren ja längst vorbei, weil die unaufhaltsamen Wachstumstitel, insbesondere die großen Techriesen, längst die Führung an der Börse übernommen haben. Aber keiner hat es bisher wahrhaben wollen.
Das sei es beileibe nicht, argumentiert dagegen Hedgefonds-Milliardär Cliff Asness von AQR Capital Management. Das Konzept des Value-Investierens, das durch Altmeister wie Benjamin Graham und Warren Buffet bekannt wurde – es sei nicht tot. Es hänge auch nicht davon ab, wie ein paar technologische Fortschrittsaktien laufen. Es gab schon mehrere Phasen, in denen Value-Aktien einige Jahre lang über Gebühr abgestraft worden waren, auch in den 60er-Jahren war das bereits so, als sich alle Welt auf die neuen Forschrittsaktien stürzte wie IBM oder Xerox. Im Dotcom-Boom der 90er-Jahre hieß es ebenfalls, die Tech-Aktien würden nun als Wachstumswerte alles überflügeln und wenn die Old-Economy von der Börse abgestraft würde, dann läge das eben daran, dass sie kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr habe. Aber ist es wirklich so?
Dazu muss man sich einmal vor Augen halten, was der Vaule-Ansatz eigentlich besagt: Er basiert auf der einfachen Beobachtung, dass vom Markt nicht alle Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt gleich bewertet werden. Sondern dass es stets überbewertete Aktien gibt, genau wie unterbewertete Aktien, die weit unter ihren fairen Preisen gehandelt werden. Wo diese fairen Werte liegen, das lässt sich anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses und des Kurs-Buchwert-Verhältnisses grob abschätzen. Vorsicht aber, denn diese Kennzahlen allein sagen längst nicht alles. Sonst dürfte man solche Aktien wie die von Amazon ja gar nicht kaufen. Und das hat jüngst selbst Value-Investor Warren Buffet getan.
Um wirklich sicherzugehen, muss man aber noch eine Reihe anderer Bilanzzahlen der Unternehmen ansehen: Wie sind ihre Cashflows, ihre Erträge, ihre Verschuldung? Man muss also tief in die Unternehmensbilanzen gucken. Wenn man das tut, dann findet man immer Unternehmen, die augenblicklich von der Börse stärker abgestraft werden und extrem niedrig bewertet sind. Ebenso wie jene, die alle anderen davonlaufen, weil Investoren viel Hoffnung auf sie setzen.
Suche nach den wahren Value-Werten
Denn Aktienkäufer sind Menschen. Und Menschen bringen immer ein wenig auch ihre Emotionen und Hoffnungen in ihre Börsenkäufe ein. Deswegen handeln Menschen heute auch nicht rationaler als in früheren Jahren. Die Unterbewerteten, die gibt es also immer – und irgendwann kehren sie wieder zu ihrer Normalberwertung zurück. Genau das nämlich ist der Unterschied von Value-Investoren zu jenen, die einfach nur günstige Aktien kaufen: Sie kaufen eben nicht die herunter geprügelte Bankaktie, die deshalb so billig zu haben ist, weil die Bank Probleme mit ihrem Geschäftsmodell und den Erträgen hat. Sondern sie suchen gezielt nach jenen, die für das Potenzial, das sie haben, unter Wert verkauft werden.
Spannend ist nun aber folgende Entdeckung von Cliff Asness, der dazu die Börsendaten in den vergangenen rund 50 Jahre auswertete: Er ermittelte eine Kurve, die anzeigt, wie weit jeweils die Kurse der unterbewerteten Aktien von denen der überbewerteten abwichen. Rund um große Börsenkrisen klaffte der Abstand aber immer recht weit auseinander. Doch normalerweise, also in normalen Börsenjahren, waren die Unterbewerteten etwa viermal so günstig wie die Überbewerteten. In früheren Krisen waren die Überbewerteten auch mal acht oder zehnmal so teuer wie die Underdogs. Aber zurzeit liegen beide um den zwölffachen Wert auseinander. Liegt das jetzt nur am gigantischen Aufstieg der Tech-Aktien?
Nein, denn rechnet man die Tech-Branche heraus, ergibt sich dasselbe Bild. Auch wenn man nur die sieben großen Megacaps außen vor lässt, also die Googles, Amazons, Microsofts dieser Welt, die nicht nur eine enorme Marktkapitalisierung haben, sondern auch allesamt mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen aufwarten, die weit über jenen liegen, die Analysten für fairer Werte halten – dann ändert das nur ein ganz klein wenig. Die Spanne bleibt aber immer noch fast genauso weit. Auch beim Herausrechnen der absolut teuersten Aktien ergab sich dasselbe Bild. Was Asness zu der Aussage verleitet: Hier sorgt nicht nur eine Branche, oder wenige Vorzeigeunternehmen dafür, dass die Spanne zwischen den Überschätzten und den Unterschätzten immer größer wird, sondern es ist ein universales Problem, dass sich über den gesamten Markt zieht.
Die Erkenntnis daraus ist folgende: Für Aktien, die sie besonders mögen, zahlten Investoren schon immer mehr Geld als für Aktien, die ihnen nicht so wertvoll erschienen. Doch zuletzt ist die Bereitschaft, für Lieblingsaktien mehr zu bezahlen – und dafür ungeliebte abzustrafen – offenbar noch stärker gestiegen als sonst. Und zwar über alle Branchen und Aktien hinweg. Gerade das bestärkt so manchen Analysten darin, dass es zurzeit etliche Aktien gibt, die vom Aufschwung „vergessen“ werden. und die ihre große Zeit demnächst wieder vor sich haben müssen. Wahre Value-Werte eben, hinter denen Qualitätsfirmen und Marktführer stecken, Gesundheitsfirmen oder Lebensmittelgroßkonzerne, aber auch Halbleiterhersteller oder Techfirmen, mit denen man zumindest die nächsten Monate, wenn nicht gar Jahre gut überstehen wird. Wenn sie wieder zu ihrem wahren Wert an der Börse zurückfinden.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden