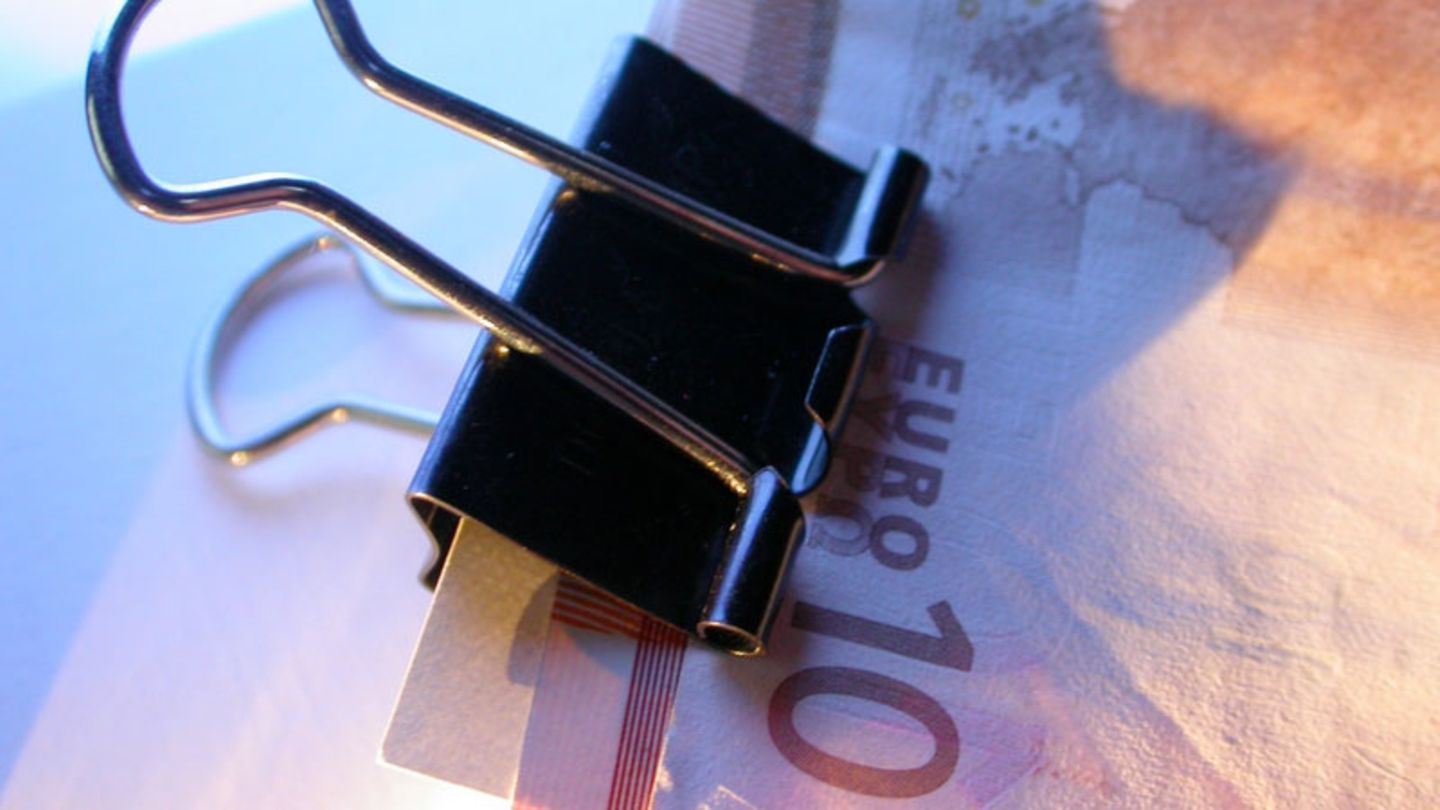Der Rentner kam gut gerüstet zum Termin: Mit sechs dicken Aktenordner wollte er es dem Finanzbeamten so richtig zeigen. Wie in jedem Jahr hatte der Staatsdiener etliche Ausgaben für die vier vermieteten Mehrfamilienhäuser nicht anerkannt. Und wie in jedem Jahr klagte der Eigentümer dagegen. Sechs Verfahren waren mittlerweile beim Finanzgericht Rheinland-Pfalz anhängig.
Doch dieses Mal war die Einladung zum Termin von der Richterin Barbara Weiß gekommen. Das verlockende Ziel der Zusammenkunft: Alle offenen Streitfälle des Rentners könnten per Mediation auf einmal geklärt werden. Die Spielregeln dabei: Die Richterin werde nicht urteilen, sondern als Mediatorin zwischen ihm und dem Fiskus moderieren. Ziel sei eine einvernehmliche Lösung. Gehe das schief, bliebe immer noch die Gerichtsverhandlung. Der Rentner willigte ein, das Finanzamt auch.
Das Treffen war ein großer Erfolg. Im persönlichen Gespräch nahm der Finanzbeamte dem Rentner ab, dass dieser 20- bis 30-mal pro Jahr zu einem seiner Mietobjekte fuhr, um dort Schnee zu räumen oder zu werkeln. Offenbar waren die Mietshäuser zum wichtigsten Lebensinhalt des Ruheständlers geworden. In der Steuererklärung hatte der Sachbearbeiter die vielen Fahrten nicht anerkannt. Auch der Rentner sah ein, dass der Beamte ihn nicht piesacken wollte, sondern laut Gesetz gar nicht anders handeln konnte. So einigten sich beide – und das Gericht hatte auf einen Schlag sechs langwierige Verfahren erledigt.
Eine solche Mediation könnte bald zum Alltag an Finanzgerichten (FG) gehören. Ermöglicht wird dies durch das "Mediationsgesetz", das am 26. Juli 2012 in Kraft trat. Zuvor war eine Schlichtung wie die von Richterin Barbara Weiß nur im Rahmen eines rheinland-pfälzischen Modellkonzepts durchführbar.
Das neue Gesetz bildet nun bundesweit die Grundlage für Gütetermine an Gerichten. Und zwar ausdrücklich auch dann, wenn ein Streit zwischen Steuerzahlern und Finanzverwaltung vor dem Richter landet. Capital erklärt die Hintergründe des neuen Verfahrens und erläutert, in welchen Fällen es Steuerzahler bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Finanzamt anstreben sollten.
Dass die Finanzgerichte ins neue Gesetz aufgenommen wurden, war keinesfalls selbstverständlich. Während der Beratungen zum Wortlaut der Paragrafen tobte ein erbitterter Streit zwischen Befürwortern und Gegnern. In den vielen neuen Entwürfen waren die Steuergerichte mal aufgeführt, dann wieder draußen.
Die Gegner argumentierten, dass die zu zahlende Steuer nicht ausgehandelt werden dürfe und mögliche Deals zwischen Fiskus und Steuerzahlern die für das Steuersystem fundamentale "Gesetzmäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung" verletzten.
Höhepunkt des Konflikts war die Intervention von Rudolf Mellinghoff, Präsident des Bundesfinanzhofs (BFH). Er warnte vor einem "Geschacher mit dem Fiskus". An den Bremer Bürgermeister Jens Böhrnsen, damals Vorsitzender des Vermittlungsausschusses, appellierte er, "dafür zu sorgen, dass eine gerichtsinterne Mediation nicht auf das finanzgerichtliche Verfahren ausgedehnt wird". Denn, so heißt es in dem Brandbrief, der Capital vorliegt, es drohe "die Gefahr einer fundamentalen Fehlentscheidung durch den Gesetzgeber".
Manche Bundesländer mauern
Doch der Brief half nichts, die Politik blieb unbeeindruckt. Vor allem der Rechtsausschuss des Bundestags pochte mehrheitlich darauf, die Finanzgerichte ins Gesetz aufzunehmen. Wohl auch, weil selbst die Gegner der gerichtsinternen Mediation in Gesprächen abseits öffentlicher Polemik einräumen, dass es beim Streit zwischen Steuerzahlern und Fiskus immer wieder Situationen gebe, in denen ein Sachverhalt unklar sei und es letztlich auf einen Kompromiss hinauslaufe. "Tatsächliche Verständigung" heißt das dann im Fachjargon. Und die ist beispielsweise bei Betriebsprüfungen oder sogenannten Erörterungsterminen vor der Gerichtsverhandlung gelebte Praxis.
Nun hängt es jeweils vom einzelnen Steuergericht ab, ob es die gerichtsinterne Mediation einführt – oder einfach ignoriert. Derzeit spaltet das Thema die Richterschaft in drei Lager. Die Vorreiter bilden die kleinste Gruppe. Sie freuen sich darauf, mit Güteverfahren zwischen Steuerzahlern und Fiskus zu schlichten. Dann gibt es das Gros der Skeptiker, die erst einmal abwarten wollen, bis Kollegen sie möglicherweise doch mit erfolgreichen Praxisfällen überzeugen. Und dann sind da noch die strikten Gegner, die in der Finanzgerichtsmediation nur eine gesetzgeberische Fehlleistung sehen.
Capital wollte wissen, wie sich diese Gruppen regional verteilen. Das Ergebnis der schriftlichen Anfrage, die jedes Finanzgericht beantwortet hat: Die stärksten Gegner sitzen im Südwesten und im Nordosten der Republik. Das FG Baden-Württemberg sieht zum Beispiel "keinen Handlungsbedarf", einen Güterichter zu bestellen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt wurde niemand mit der Aufgabe betraut.
Im Saarland hält man die gerichtsinterne Mediation zwar ebenfalls für "völlig ungeeignet" bei Steuerstreitigkeiten, agiert aber subtiler als die Totalverweigerer: "Wir haben jeweils die Vorsitzenden der Senate (vorsorglich) benannt (ohne hiervon aber Gebrauch machen zu wollen)", heißt es in der Antwort an Capital.
Andernorts ist man dem neuen Gesetz gegenüber deutlich aufgeschlossener: So wurden an 15 der insgesamt 18 deutschen Finanzgerichte 32 Güterichter benannt. Selbst wenn man die zwei Mogelbenennungen in Saarbrücken herausrechnet, haben Steuerzahler also in fast allen Regionen die Chance, die Mediation durch einen Richter anzustreben, nachdem sie Klage eingereicht haben. Am aussichtsreichsten ist das derzeit in Hessen: Dort sei ein Güteverfahren bereits erfolgreich abgeschlossen, ein zweites terminiert und für sechs weitere liefen gerade die Vorbereitungen, so die Auskunft aus Kassel. In Münster, Hamburg und Thüringen stehen demnächst ebenfalls erste Verfahren an. Und in Schleswig-Holstein und Köln werden gerade Anfragen von Klägern geprüft, die eine Schlichtung wünschen.
Es gibt einen großen Vorteil einer gerichtsinternen Mediation: "Die Arbeitsatmosphäre und das Gesprächsklima sind erheblich ungezwungener und freier als bei einer Gerichtsverhandlung", sagt Richterin Weiß.
Die Beteiligten seien offener, schon allein weil sie wüssten, dass der Güterichter nicht die Person sein wird, die später das Urteil fällt, falls keine Einigung zustande kommt. Denn alle Verfahren werden von den Richtern, die eigentlich laut Geschäftsordnung zuständig sind, an die Mediationskollegen weitergeleitet.
Kommt es zum Termin, sorgen allein schon die äußeren Umstände für eine andere Grundstimmung: Die Juristen tragen keine Robe, und bei den meisten Finanzgerichten finden die Güteverhandlungen abseits der Gerichtssäle in speziellen Räumen statt. In Hannover wurde dazu extra ein Zimmer "in hellem, freundlichem Gelb gestrichen", so der FG-Sprecher. Und in den Steuergerichten in Hessen und Rheinland-Pfalz sollen Flipcharts und Pappkarten, die an die Wand gehängt werden, helfen, den Konflikt gütlich zu lösen. Es wird ein konstruktives Workshopklima angestrebt: So obliegt es dem Güterichter in Hamburg, durch "Zur-Verfügung-Stellung von Kaffee für eine angemessene Atmosphäre zu sorgen", wie das Finanzgericht der Hansestadt schreibt.
"Der wichtigste Erfolgsfaktor ist die Kommunikation", sagt Richterin Weiß. Denn anders als beim Erörterungstermin, mit dem oft die mündliche Gerichtsverhandlung vorbereitet wird, zählt beim Gütetreffen weniger die Akte als vielmehr der Mensch und seine Geschichte. Sie lasse generell die Betroffenen, also Steuerzahler und Finanzbeamte, die strittige Situation erst einmal selbst darstellen. Denn "Akte ist eben nicht immer gleich Lebenswirklichkeit". Die eigene Sicht darstellen zu können wirke ungemein befreiend. "Vor allem, weil der andere Part gezwungen ist, diese anzuhören", sagt Steuerrechtlerin Weiß.
Dieser Austausch und die Sicht auf die Situation des Gegenübers sind die Basis, miteinander Einigungen zu erzielen (siehe unten). "Ich moderiere nur, die Lösungsvorschläge sollen von den Parteien kommen", betont Weiß.Durch diese dialogorientierte Kommunikation sind die Güteverfahren vor allem für Fälle geeignet, in denen das Verhältnis zwischen Bürger und Finanzamt stark gestört ist. Zum Beispiel wenn es immer wieder zwischen Steuerzahler und Sachbearbeiter kracht, Unternehmer sich ständig vom Betriebsprüfer schikaniert fühlen oder der Beamte umgekehrt glaubt, der Geschäftsmann verkaufe ihn jedes Mal für dumm.
Gelingt die Einigung, lohnt das auch finanziell. Denn wenn die "Klage zurückgenommen" oder die "Hauptsache für erledigt erklärt" wird – und das ist die Konsequenz einer Mediationsvereinbarung –, fallen nur die halben Gerichtsgebühren an.
Wer vor einem Finanzgericht klagt, muss allerdings stets 220 Euro bezahlen. Diese Summe wird erst einmal für einen Mindeststreitwert von 1000 Euro angesetzt. In der Regel ist dieser meist höher, was die Kosten später steigert. Da sich der Rabatt nach erfolgreichem Gütetermin auf den tatsächlichen Streitwert bezieht, werden also die 220 Euro oft überschritten. Fällig ist jedoch stets nur die Hälfte der Summe, die bei einem Urteil zustande käme.
Steuerjuristen appellieren, bei der Entscheidung für ein Mediationsverfahren nicht nur den Kostenvorteil zu sehen. Wichtiger sei gegenseitiges Verständnis zwischen Bürger und Amt: "Ideal wäre es, wenn nach einem Güteverfahren spätere Konflikte ohne Klage gelöst werden könnten", hofft Richterin Weiß.
Gütetermin - So kommen Sie ins Gespräch
Die wichtigsten Fakten zu den neuen Verfahren an Finanzgerichten.
Unkompliziert Ein Güteverfahren am Finanzgericht ist nur möglich, wenn gegen einen Steuerbescheid geklagt wurde. Der Mediationswunsch kann gleich mit der Klage eingereicht werden oder nachträglich. Eine bestimmte Form ist nicht nötig. Das Gericht prüft die Anträge und leitet geeignete Fälle an den Güterichter weiter. Finanzgerichte, die das neue Verfahren begrüßen, werden auch selbst Güteverfahren anregen.
Zustimmungspflichtig Einem Gütetermin müssen alle Beteiligten zustimmen – also der Steuerzahler, das Gericht und das Finanzamt. Noch ist offen, wie die Finanzverwaltung auf Chancen zur Schlichtung reagieren wird. Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen sieht laut einer aktuellen Verfügung "keinen Anlass", ein Mediationsverfahren anzuregen. Gehe die Initiative dazu allerdings vom Steuerpflichtigen oder dem Gericht aus, bestünden "keine Bedenken, sich an diesem zu beteiligen" (Az.: FG 1077-1-St 143). Höhere Beamte der Oberfinanzdirektion Koblenz schließen hingegen nicht aus, in geeigneten Fällen selbst eine gerichtsinterne Mediation zu initiieren.
Konsensorientiert Was jeder wissen sollte, der über eine Mediation nachdenkt: Beim Güteverfahren geht es darum, dass die Konfliktparteien selbst eine Lösung erarbeiten. Die Bereitschaft, zuzuhören und dabei mehr Verständnis für die andere Position aufzubringen als während des vorausgegangenen Schriftwechsels zwischen Bürger und Amt, ist dabei unabdingbar. Der Güterichter moderiert, hilft bei der Lösungsfindung, wird diese aber in der Regel nicht unterschriftsreif vorgeben. Scheitert der Gütetermin, entscheidet letztlich doch das Gericht über die Klage.