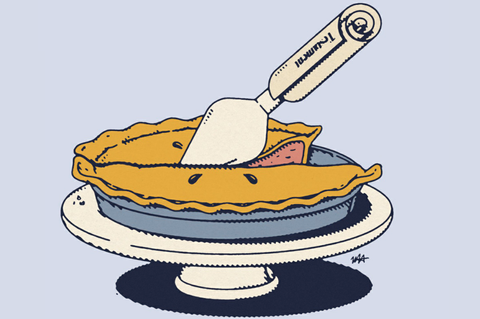Nicht ohne Larmoyanz wird in der öffentlichen Diskussion vermerkt, dass Deutschland und Europa im Begriff stehen, bei neuen internetbasierten Technologien ins Hintertreffen zu geraten. Außer kollektivem Gejammer nebst den erwartbaren Schuldzuweisungen fällt der politischen Elite Deutschlands aber wenig Konkretes dazu ein. Auffällig ist vor allem die unzureichende Ursachenanalyse für das gefühlte Zurückfallen. Es fällt scheinbar niemandem in Berlin auf, dass es die überlegene Finanzmarktkultur Amerikas ist, die zu den Marktführern in den Internet-Gewerken geführt hat.
Während man es hierzulande in politischen Zirkeln vorzieht, eine distanzierte und zum Teil verachtende Attitüde gegenüber der Börse und Eigenkapitalanlagen (Aktien und Aktienfonds) an den Tag zu legen, weiß man auf der anderen Seite des Atlantiks um die segensreiche Innovationsdynamik, die durch die Finanzmärkte animiert und in Schwung gehalten wird. Und das Geld folgt bekanntlich der Attraktivität eines Marktes. Mehr als 70 Prozent des weltweiten Handelsvolumens in Aktien findet mittlerweile in den USA statt, wie die Handelschefin von Fidelity Investments kürzlich mitteilte.
Hierzulande bleibt dagegen weithin unbeachtet, dass Unternehmen wie Amazon, Uber oder Tesla ihr Wachstum und Frühphasenüberleben ausschließlich der breiten und tiefen amerikanischen Finanzmarktkultur zu verdanken haben. Bei den selbstfahrenden Autos oder digitalen Bezahlsystemen wird es nicht anders sein. Ohne risikobereite Frühphaseneigenkapitalgeber (Venture Capital) gäbe es die Unternehmen nicht. Und ohne die nachfolgende Kette weiterbesitzender Eigenkapitalgeber (Private Equity Fonds, Aktienfonds, Hedgefonds, Beteiligungsgesellschaften, Pensionsfonds, Vulture Fonds etc.) hätten Frühphasenfinanzierer keine Chance, ihre Früchte zu ernten und nach neuen unternehmerischen Möglichkeiten Ausschau zu halten.
Unbehagen gegenüber Börse und Finanzmarkt
In Deutschland sorgen allein schon die leistungsfeindlichen Steuergesetze dafür, dass die Venture Capital Szene ein bescheidenes Dasein fristet. Die Regierenden – ihrerseits in der Regel Berufspolitiker – ziehen es vor durch staatliche Großbanken wie der KfW, Sonderförderungsprogramme ins Leben zu rufen. Man darf sich darüber nicht wundern, denn die seit Jahrzehnten geförderte Fremdkapitalkultur mit ihren staatlichen Privilegien gegenüber Eigenkapitalanlagen ist in den Köpfen mittlerweile fest verankert. Und ein Finanz- und oder Wirtschaftsminister, der wie in den USA oftmals von der Wall Street kommt, wäre in Deutschland völlig undenkbar. Der Parteienproporz verhindert den Einstieg von kompetenten Quereinsteigern zur Gänze; Gender- und andere Quoten sorgen für den Rest.
Ein grundsätzliches Unbehagen gegenüber Börse und Finanzmarkt findet seine Spiegelung in der verkümmerten deutschen Aktienkultur. Die mutigen Schritte des Reformkanzlers der Deutschen – der parteipolitisch ungeliebte Gerhard Schröder – sind inzwischen Historie. Mit Schröders Namen ist die Agenda 2010 verbunden, die ja zugleich auch eine ernstzunehmende Steuerreform war.
Unter Angela Merkel hat sich hernach ein Gouvernantenstaatsmodell ausgebreitet, das sich in Weltverbesserungsideologien verrannt hat und überhaupt keinen Zugang zu marktwirtschaftlichem Denken besitzt. Die Hypothese der Kanzlerin, durch den überhasteten Atomausstieg den Grünen die Existenzgrundlage zu entziehen, hat sich als existenzieller Fehler erwiesen. Denn die Grünen, die in ihrem Kern Neigungen zu einer totalitären Verbotspartei aufweisen (Fleisch, Kohle, Diesel, Autos etc.), haben seither mit dem Klimawandel ein neues Gewinnerthema finden können, mit dem sie die Altparteien CDU und SPD vor sich her treiben. Diese haben mit einem strammen Linksrutsch auf die Bedrohung durch die Grünen reagiert und dabei mittlerweile sämtlichen ökonomischen Sachverstand auf der Strecke gelassen.
Es geht aber Deutschland keineswegs schlecht genug, um wie seinerzeit nach den chaotischen Anfangsjahren des Gerhard Schröder eine Notwendigkeit für Reformen zu verspüren. Dafür ist nicht zuletzt auch die Europäische Zentralbank mitverantwortlich, denn deren Nullzinspolitik hat es der Politik bislang ermöglicht, keine zusätzlichen Staatsschulden aufnehmen zu müssen. Hoffentlich hat dieser paradiesische Zustand noch lange Bestand.
Dr. Christoph Bruns