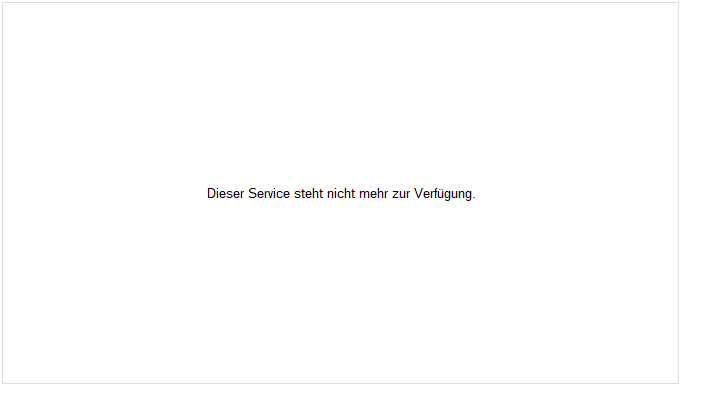Inzwischen mag man es ja kaum noch glauben, aber: Raten Sie mal, wer bis Ende April noch der absolute Top-Performer im Bankenindex Stoxx 600 Banks war? Es war die Commerzbank. Ausgerechnet sie legte seit Jahresbeginn die beste Kursperformance aller europäischen Banken hin und ließ alle anderen hinter sich. Gerade jene Bank, von der sich seit Wochen viele Marktbeobachter wünschen, sie möge doch endlich einen Käufer finden – der aber einfach nicht auftauchen mag. Denn schon länger – und nach 2013 auch schon zum zweiten Mal - hält die gelbe Bank vom Main nun nach einem Konkurrenzinstitut Ausschau, das sie nun endlich vom zerstörerischen Wettbewerb auf dem Bankenmarkt befreien kann. Indem es sie schluckt.
Der neueste Versuch in diese Richtung schlug aber gerade erst wieder fehl: Auch die niederländische ING, die zuletzt als neuer Commerzbank-Partner im Gespräch war, hat dem Vernehmen nach nun doch kein Interesse an einer Fusion . Damit droht die Commerzbank endgültig zum Ladenhüter zu werden. Denn auch die italienische Unicredit wurde als potenzieller Übernehmer gehandelt, macht aber keinerlei Anstalten, das auch zu werden. Die Deutsche Bank hatte ja schon vor Wochen abgewunken . Und auch aus Frankreich kamen längst Absagen statt eindeutiger Angebote. Da steht also eine der beiden deutschen Großbanken zum Sonderschlussverkauf im Schaufenster, mit niedrigem Börsenkurs und einer Marktkapitalisierung von nur 7,7 Mrd. Euro – und keiner greift zu.
Die Frage ist nun: Was bedeutet das für – oder was sagt es über – die hiesige Bankenlandschaft? Und wie passt dazu der rasante Kursanstieg seit Jahresbeginn? Er kam zum einen zustande, weil die Bankaktien im Kursabstieg vom Herbst/Winter auch überdeutlich abgestraft wurden. Und sich daher im Vergleich zu anderen Werten gut erholten. Und er speiste sich zum anderen vorwiegend aus Übernahmefantasien, so viel ist inzwischen klar. Denn von Dezember bis Ende April kletterte der Commerzbank-Kurs von knapp 6 Euro auf über 8 Euro. Doch seit Mai – seit die Deutsche Bank die Übernahme abblies – hat die Bank den allergrößten Teil ihres Vorsprungs gegenüber den anderen wieder eingebüßt.
Wie weit geht der Absturz?
Inzwischen belegt sie auf der Performanceliste auf Monatssicht einen der hinteren Plätze, denn sie hat allein auf Vierwochensicht wieder 18 Prozent abgegeben. Das ist eine ganze Menge. Neuerdings rauscht der Kurs wieder ungebremst nach unten und hat sich bereits von 8 Euro auf 6,20 dezimiert. Und auch auf Jahressicht rangiert sie weit abgeschlagen im hinteren Feld der Europabanken mit rund 35 Prozent Kursminus. Allerdings steht die Deutsche Bank mit knapp 37 Prozent noch hinter ihr, sie lief also auf Jahressicht noch schlechter.
Und wie immer in solchen Fällen fragen sich die Börsianer, wie weit der Absturz wohl noch weitergehen wird. Vor einem Jahr kostete die Aktie schließlich noch über 9 Euro, im Januar 2018 sogar noch 13 Euro. Wenn sie jetzt wieder nahe ihres Allzeittiefs von 5,80 notiert, ist sie dann nicht genug abgestraft? Und kann es dann nicht nur noch bergauf gehen? So ist es, rufen die ersten Charttechniker: Die Bodenbildung sei jetzt da.
Der Kurs werde also höchstwahrscheinlich bald wieder nach oben drehen. Sie erinnern dann auch gerne daran, dass der Kurs 2007 schließlich noch bei 200 Euro gestanden hätte. Überdies sei das Papier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 enorm unterbewertet. Der Dax und die Deutsche Bank kommen auf ein weitaus höheres KGV, auf ungefähr 13. Allerdings pendelt der Commerzbank-Kurs nun auch schon seit 2011 lediglich um die 10-Euro-Marke herum. Also schon viele Jahre. Gerade wenn man sich den Kurs seit den frühen 90er-Jahren ansieht, kommen einem arge Zweifel, ob diese Aktie nicht längst die besten Zeiten hinter sich hat.
Vielleicht ist die Commerzbank jetzt wirklich am Boden angekommen, zumindest auf dem Boden der Tatsachen. Denn dass die Deutsche Bank nicht gut daran täte, sich mit dem gelben Konkurrenten zusammenzuschließen, hielten viele Marktbeobachter für allzu logisch und auch offensichtlich. Zwei Versehrte ergäben schließlich noch lange keinen Gesunden, so drückten es kritische Stimmen aus. Und wie gut es derzeit um die Finanzkraft der Deutschen Bank selber bestellt ist, das ließ dieser Tage auch das neue Rating von Fitch erahnen. Die Agentur stufte Deutschlands Bankenprimus auf das BBB-Niveau herab . Kurz zuvor hatte Moody´s zwar seine Einschätzung beibehalten, ergänzte das Rating aber um den Zusatz „negativer Ausblick“ und strafte damit die Deutschbanker ebenfalls ab. Von daher ging die Absage des deutschen Konkurrenten angesichts der wackligen Beine, auf denen er steht, noch in Ordnung.
Den anderen europäischen Banken geht es besser
Dass aber nun auch die europäische Konkurrenz davor zurückscheut, sich die Commerzbank näher anzusehen, spricht Bände. Die war zwar zuletzt ebenfalls nicht gerade erfolgsverwöhnt. Und sie stöhnt auch wie die hiesigen Institute mächtig über die Niedrigzinsphase und die schwindenden Margen im Geschäft. Insgesamt aber stehen die Banken in Frankreich, den Beneluxländern und sogar in Spanien noch sehr viel besser da als die deutschen.
Am augenfälligsten wird das bei den Kursen: Während die deutschen Großbanken im Dax Subsektor Banken auf Jahressicht 33 Prozent einbüßten, verlor der europäische Bankenindex Stoxx 600 Banks „nur“ 21 Prozent. Auf drei Jahre war der Verlust der europäischen Banken mit 5 Prozent marginal, dagegen gaben die deutschen Banken satte 34 Prozent ab. Und auf Zehnjahressicht? Da rappelten die Europabanken zwar um 30 Prozent bergab, doch die Kurse der deutschen Institute zerlegte es sogar um 73 Prozent. Also mehr als doppelt so stark. Auch im Vergleich vom Höchststand 2007 bis heute siegen die Europabanken: Ihre Kurseinbußen fielen seit der Finanzkrise mit 75 Prozent zwar üppig aus, aber dennoch etwas kleiner als die des Dax-Subsektors, der immerhin 81 Prozent abgab. Damit die Branche diesen Absturz wieder aufholt, müsste sie also um ein Vielfaches zulegen.
Steht es um deutsche Banken also wirklich so schlecht? Im Vergleich ja. Denn auch die anderen europäischen Institute leiden zwar unter den Niedrigzinsen und sinkenden Margen. Aber einige Dinge scheinen sie besser verkraften zu können als die hiesigen Geldhäuser: Sie erzielen mehr Ertrag je eingesetztem Kapital, sammeln große Einlagesummen an – das machen die deutschen Institute zwar auch – aber die europäische Konkurrenz wirtschaftet damit anscheinend besser. Sie vergibt vor allem mehr Kredite, also Risikokapital, dass sie sich gut bezahlen lassen kann. Und sie schafft es, mehr Provisionseinnahmen zu erzielen besonders aus dem Wertpapiergeschäft. In Summe sind ihre Erträge daher weitaus üppiger als die von Commerzbank, Deutscher Bank und Co. und das, obwohl die deutschen Institute auch noch massiv ihre Kosten heruntergefahren haben – was man von den europäischen Konkurrenten nicht gerade sagen kann. Europas Banken sind daher zwar besser im Geldausgeben, aber auch weitaus besser im Geldverdienen.
Buffett setzt auf amerikanische Institute
Sollte man angesichts dieser Fakten besser überlegen, in den europäischen Bankensektor zu investieren? Der Stoxx 600 Banks sieht ja zumindest in der mittelfristigen Dreijahresbetrachtung so aus, als könne er demnächst wieder nach oben drehen und zu einem neuen Aufwärtstrend aufbrechen. Doch bevor man darauf setzt, sollte man lieber einmal kurz innehalten und sich an Warren Buffett orientieren: Der hat sich zwar gerade erst üppig mit frischen Bankaktien eingedeckt. Mit amerikanischen allerdings. Dafür hat er sogar seine Apple-Aktien verkauft.
Insgesamt besteht Buffetts Portfolio nun zu gut 46 Prozent aus Finanzwerten. Das will bei einem Investor wie ihm einiges heißen. Denn das kann man schon ein Klumpenrisiko nennen und das ginge ein Starinvestor wie Buffet doch nur ein, wenn er sich seiner Sache absolut sicher fühlte. Buffett setzt traditionell nur auf Großunternehmen mit stabiler Geschäftsentwicklung, die sich stark am Markt behaupten, dafür ist er bekannt. Er wählt also seine Investments aufgrund der fundamentalen Stärke der Unternehmen aus. Und setzt auf Firmen, denen seiner Meinung nach der Langfristerfolg beschieden ist.
Zumindest haben die amerikanischen Banken sich seit der Finanzkrise wieder ordentlich nach oben gearbeitet. Den Kurseinbruch von 2007/2008 haben sie sogar beinahe wieder aufgeholt, sie liegen nur noch 24 Prozent im Minus. Also weit weniger als ihre Konkurrenten aus Europa. So gesehen haben sie Stärke gezeigt. Und auch ihre Gewinne sprudeln wieder reichlich, was daran liegt, dass die amerikanische Notenbank Fed bereits vor einer Weile wieder die Zinsen auf ein erträgliches Maß angehoben hat. Auch wenn sie zuletzt andeutete, dass es mit der Anhebung wohl bald wieder vorbei sein wird. Dennoch: Die Ausgangsposition für US-Banken ist weitaus günstiger als die der Banken hierzulande.
Der Langfristerfolg am Markt setzt aber auch voraus, dass die Institute sich gegen die kommenden Umwälzungen am Markt durchsetzen können. Die gehen einerseits von einer erneuten Zinserosion aus – und es wird spannend, was in Europa passieren wird, wenn sich die Weltwirtschaft abkühlt und Amerika daraufhin seine Leitzinsen stark senken wird. Und andererseits müssen die Banken auch dem Angriff der Fintechs widerstehen um zukunftsfit zu bleiben. Gerade die Fintechs erfordern derzeit ein Umdenken in den Banken, weil sie deren etabliertes Geschäftsmodell angreifen. Die Kraft, beide Herausforderungen zu meistern, haben wohl vorwiegend die ganz großen Insititute des Sektors, findet Warren Buffet. Zu denen zählt er zum Beispiel JP Morgan, die Bank of America und die Bank of New York. Die europäischen Geldhäuser gehören zu diesem Kreis ganz offenbar nicht. Gemessen an diesen Instituten nämlich sind sie auch viel zu klein. Ohne Zusammenschlüsse erst recht.