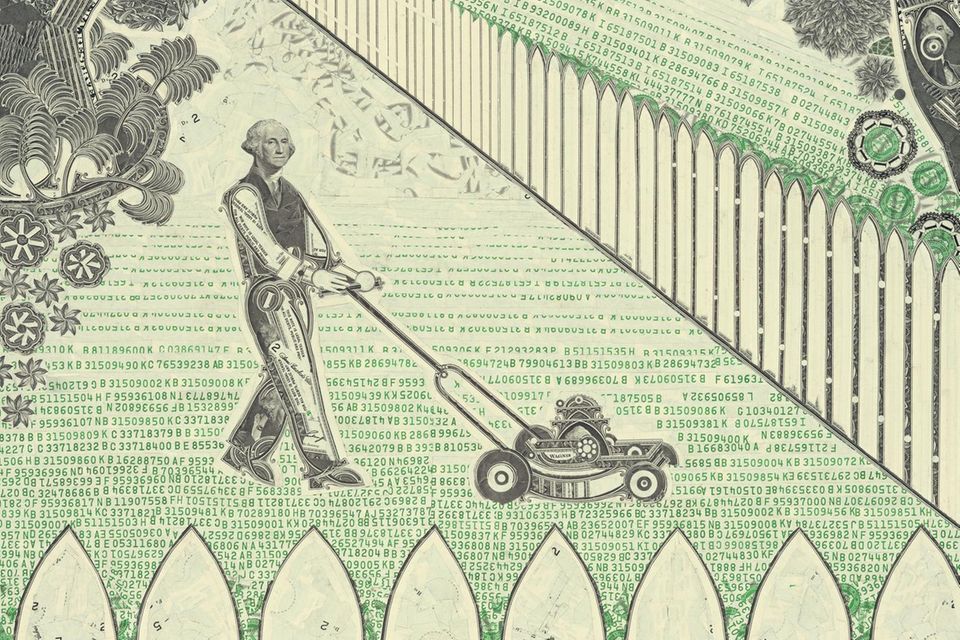Capital: Herr Bofinger, FDP-Chef Christian Lindner hat vorgeschlagen, Kryptowerte in die Reserven von EZB und Bundesbank aufzunehmen. Was halten Sie von der Idee?
PETER BOFINGER: Das Mandat von EZB und Bundesbank ist Preisstabilität. Die Frage ist: Braucht es Bitcoins, um diesem Mandat besser gerecht zu werden? Meine Antwort ist eindeutig: Der Bitcoin-Kurs hat keinerlei Auswirkungen auf die Geldwertstabilität oder auf andere gesamtwirtschaftliche Prozesse in Deutschland. Daher gibt es für Bundesbank oder EZB nicht die geringste Notwendigkeit, Kryptoreserven aufzubauen.
Wenn das offensichtlich so wenig Sinn ergibt, warum schlägt Lindner es dann vor?
Der Vorschlag kam ja nicht von Herrn Lindner, sondern ursprünglich von Herrn Trump. Und da gibt es natürlich eine sehr klare Rationalität, denn die Krypto-Industrie hat Trump im Wahlkampf massiv gefördert. Da muss er nun liefern. Und wenn er fordert, die Fed sollte Bitcoin ankaufen, ist das ein sehr wirksames Programm, um den Kurs nach oben zu bringen.
Um mehr geht es nicht? Der FDP-Chef hat den Vorschlag ja auch damit begründet, dass sich Deutschland und Europa bei Kryptowährungstechnologien nicht abhängen lassen dürften.
Klar, man kann sicher diskutieren, wie man mit der Technologie umgeht oder wie man sie reguliert. Aber noch einmal, es gibt dabei keine Notwendigkeit für EZB oder Bundesbank, jetzt eigene Kryptoreserven aufzubauen. Das ist ein unausgegorener Vorschlag, mit dem sich Herr Lindner an Herrn Trump hängt – bei dem klar ist, dass er dafür bezahlt wurde. Einen Gefallen hat sich Herr Lindner damit nicht getan.
Der Ex-Finanzminister bringt aber noch ein Argument vor: Krypto-Werte hätten in der Vergangenheit einen „bedeutenden Teil des globalen Wohlstandszuwachses ausgemacht“ und könnten die Notenbankreserven resilienter machen.
Man kann sich natürlich grundsätzlich fragen, wie das Portfolio einer Notenbank beschaffen sein soll. Die Bundesbank setzt auf Gold und Devisenreserven, eine sehr konservative Anlagepolitik. Das kann man natürlich hinterfragen. Aber dazu wäre eine Grundsatzdiskussion über die Bedeutung der Währungsreserven von Bundesbank und EZB zu führen, kein Schnellschuss zu Kryptowährungen.
Letztes Argument der Befürworter: Nur wenn eine Zentralbank über die entsprechenden Reserven verfügt, kann sie Marktbewegungen kontern.
Aber es sollte doch nicht Aufgabe der Notenbank sein, Krypto-Anleger vor dem Kollaps zu schützen – oder dafür zu sorgen, dass die Leute, die mit Kryptospekulationen hohe Buchgewinne erzielt haben, die auch realisieren können, ohne das Ganze zum Kollabieren zu bringen. Was natürlich auch eine Erklärung für den Versuch wäre, die Notenbanken ins Spiel zu bringen. Nur: Wäre es wirklich eine gute Idee, dass am Schluss der Steuerzahler hier aushilft, damit Investoren ihre Krypto-Gewinne realisieren können?
Trump hat gegenüber der Krypto-Industrie nicht nur von einer möglichen Reserve gesprochen, sondern auch angekündigt, die Regulierung zu lockern…
…und könnte damit den Kryptowährungen sogar eher schaden.
Wie das?
Wenn ich eine Kryptowährung halte, dann habe ich einen Anspruch auf nichts: Dahinter steht kein Gegenwert. Werden aber immer mehr Ansprüche auf nichts in die Welt gebracht und die Regeln für das Vertreiben dieser Ansprüche immer lockerer, dann besteht die Gefahr, dass die Menschen irgendwann erkennen, dass dahinter nichts steht – und dass das ganze System dann zusammenbricht. Je weiter sich das System also aufbläst, desto größer wird die Gefahr, dass die Blase platzt.
Davor, dass Bitcoin keinen inhärenten Wert besitzt, haben Volkswirte immer wieder gewarnt. Trotzdem hält sich die Kryptowährung seit Jahren gegen alle Widerstände, die Verbreitung nimmt zu, der Preis steigt. Können Sie sich das erklären?
So funktionieren eben spekulative Märkte: Entscheidend ist, dass man glaubt, dass es andere Leute gibt, die wiederum glauben, dass andere Leute glauben, dass das Ganze etwas wert ist. Keynes hat dafür mal den Begriff der Erwartung dritten oder vierten Grades ins Spiel gebracht. Es kann sein, dass zwar jeder für sich glaubt, das Ding ist nichts wert, aber solange er glaubt, dass andere glauben, dass das Ding etwas wert ist, kann dieser Prozess ziemlich lange weitergehen. Und ich muss zugeben, ich habe auch unterschätzt, welches unglaubliche Potenzial so ein spekulativer Markt wie Bitcoin hat, welche Auftriebskräfte da wirken. Trotzdem kann dieser Prozess irgendwann zusammenbrechen.
Wann denn?
Dann, wenn die Leute glauben, dass andere Leute nicht mehr glauben, dass darin ein Wert steckt. Es ist wie beim Märchen von des Kaisers neuen Kleidern – wenn wir erkennen, dass der Kaiser nackt ist. Es gibt übrigens noch eine Gefahr.
Und zwar?
Das Spannende ist ja, dass bei Bitcoin das Spiel im Prinzip klar definiert ist: 95 Prozent aller Bitcoins sind geschürft, da kann man nicht mehr viel machen. Wenn man das Geschäft noch weitertreiben will, muss man neue Kryptowährungen ins Spiel bringen. Und das wiederum kann auch dem Bitcoin schaden. Denn der Kryptomarkt ist ein Wettbewerbsmarkt und es kann gut sein, dass der Bitcoin zugunsten neuer, attraktiverer und technologisch ausgereifterer Kryptowährungen an Beliebtheit verliert. Im Augenblick liegt der Anteil von Bitcoin an der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen auch schon bei nur etwas mehr als der Hälfte.
Wäre ein Krypto-Crash eine Gefahr für das Finanzsystem?
Eine gesamtwirtschaftliche Gefahr sehe ich nicht. Wenn morgen das ganze Bitcoin-System implodiert, hätte das keine gesamtwirtschaftliche Wirkung. Wir reden bei der Krypto-Marktkapitalisierung von einer Größenordnung von etwa zwei Prozent der Weltgeldmenge. Wenn die verschwinden würde, wäre das unproblematisch. Die vielen nicht realisierten Gewinne wären halt weg. Aber das wäre kein globales Problem.