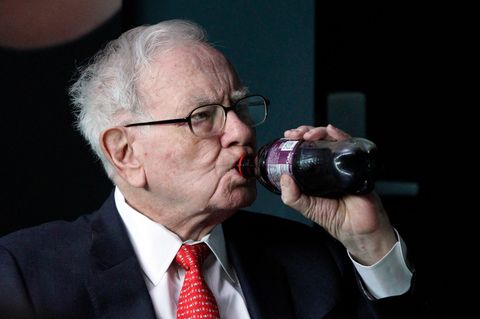Nadine Oberhuber ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Sie schreibt auf Capital.de über Geldanlagethemen
Die Lage in der Europäischen Union lässt sich im Prinzip mit einem Wort beschreiben: unübersichtlich. Wer weiß schon, was als Nächstes im griechischen Schuldendrama passieren wird, ob sich die Regierung Tsipras nicht schon morgen wieder alles anders überlegt und was Gläubiger, Bevölkerung, IWF und Weltbörsen dazu sagen? Ist Griechenland nun „bloß“ pleite, tritt es aus der Währungsunion aus – oder klagt es sich ein? Im Moment vermag es niemand zu sagen, obwohl viele Beteiligte und Marktbeobachter den derzeitigen Zustand wortreich diskutieren. Die Lage ist – in einem Wort – chaotisch. Und die Stimmung? Bei der braucht man zwei Worte: überraschend positiv.
Das war sie schon zu Beginn der vergangenen Woche, bevor das unerwartete Einlenken des griechischen Ministerpräsidenten den Optimismus noch anheizte. Die Unbekümmertheit aber hätten im Vorfeld wohl die wenigsten erwartet. Jahrelang wurde der Grexit als Super-GAU gehandelt, als größtes anzunehmendes Unheil für die Wirtschafts- und Währungsunion. Welche Sprengkraft er auf die europäischen Kapitalmärkte haben könnte, wurde häufig ausgemalt. Und jetzt? Läuft der Dax – von kurzen Bremsmanövern und Luftsprüngen mal abgesehen – robust weiter wie bisher. Zwar nicht mehr aufwärts wie 2014, doch wenigstens seitwärts. Auch die Staatsanleihenmärkte lassen sich kaum aus der Ruhe bringen. Eher fürchten sie sich vor dem amerikanischen Zinsanstieg als vor dem Ausstieg der Griechen. Das große Flattern ist bisher ausgeblieben.
Mehr noch. Fragt man die Anleger, womit sie in den kommenden Wochen rechnen – was regelmäßig Stimmungsbarometer wie der Sentiment-Index bei tausenden Anlegern tun – so sagen derzeit erstaunlich viele der Befragten: Es geht bald wieder aufwärts mit den Kursen. Über die Hälfte der Börsianer geht davon aus. Die Schar derjenigen, die einen Abwärtsdrall befürchten, hat sich dagegen in den vergangenen Wochen deutlich dezimiert. Nicht einmal jeder Fünfte rechnet mit einem Absturz der Kurse. Ist da nun der Wunsch der Vater des Gedanken und hoffen die Beteiligten das alle bloß, weil sie einen Abgrund nicht sehen und den drohenden Kurssturz nicht wahrhaben wollen? Oder sind die Anleger wirklich so abgeklärt, dass das derzeitige Chaos sie kalt lässt? Vieles spricht für Letzteres.
Optimismus beherrscht den Markt
Schließlich unterscheidet sich die Situation heute fundamental von derjenigen vor noch drei Jahren. Damals fürchtete Europa, die Griechenkrise könnte sich ausbreiten und andere Südländer anstecken: Spanien, Italien, Portugal, selbst Frankreich schien plötzlich in den Überschuldungsbann zu geraten. Die Angst ging um, dass europäische Banken kollabieren würden, weil sie doch größere Pakete griechischer Staatsanleihen in den Büchern hätten. Inzwischen haben die Banken längst diese Papiere aus ihren Beständen getilgt. Auch in Privatdepots oder den Portfolios institutioneller Anleger wie Pensionskassen liegen diese Risikopapiere kaum noch. Zudem kauft die Europäische Zentralbank weiter Staatsanleihen der übrigen Südstaaten, um sie vor dem Übergriff der Krise zu schützen. Und das griechische Bruttoinlandsprodukt macht europaweit nur zwei Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Würde Hellas nun wirklich zum Totalausfall – es schiene verkraftbar.
Der Altmeister des Börsenparketts Gottfried Heller formulierte es so: Die Welt werde Griechenland so schnell nicht aus dem Tritt bringen. Vermutlich hat sich der Großteil der Börsengemeinde also längst an den Gedanken gewöhnt, dass Hellas nicht mehr zu retten ist und es deshalb bereits in die Kurse eingepreist, wie es im Aktiensprech heißt. Einige Beteiligte werden sogar mit einem „na endlich“ reagieren. Schließlich ist irgendein Ende dieses Dramas immer noch besser als gar keins. Als Verhandlungen in Endlosschleife. Nur ein kleiner optimistischer Rest hofft wohl noch auf das „eskalierende Commitment der Gläubiger“. Also darauf, dass die Geldgeber die Griechen ohnehin nicht im Stich lassen, weil sie sonst selber Verluste realisieren müssten, was Anleger bekanntermaßen nur ungern tun. Kurzum: Optimismus beherrscht den Markt.
kein Grund zum Ausstieg
Wenn man den Anlegern glauben darf, dann lassen sie ihren Worten auch Taten folgen. Ein knappes Drittel will in den kommenden Wochen Aktien kaufen. Nur jeder Achte möchte lieber Papiere loswerden. Unterm Strich wird das die Kurse eher stützen. Die Mehrheit aber tut erstmal gar nichts, hält ihre Aktien und wartet ab.
Was ist nun die beste Strategie? Vertraut man auf die Aussagekraft des Sentiment-Index, gibt es derzeit zumindest keinen Grund zum Ausstieg. Der Index liegt über der Nulllinie – das heißt, Kaufbereitschaft ist vorhanden – jedoch keine übertrieben große. Das ist eine gute Nachricht, denn gefährlich wird es erst, wenn der Index in die Extrembereiche abdriftet, wissen die Analysten aus der Vergangenheit. Vor allem bei institutionellen Anlegern stieg zuletzt die Stimmung stark. Sie kauften zu, just als die Kurse zwischendurch sanken. Als weiterer Beruhigungsdrops wirkt der Blick auf den Goldpreis: Der bewegt sich kaum. Würde er aber, wenn große Gefahr in Verzug wäre, wenn Panik aufkäme. Also komplette Entwarnung – und jetzt kaufen, wo die Kanonen donnern?
Das nun auch wieder nicht. Natürlich können die politischen Ereignisse noch unerwartete Folgen haben und die Kurse in den Keller drücken. Bis auf 10.000 Punkte könnte es hinabgehen, vermuten einige Marktbeobachter. Doch mehr als ein Rücksetzer werde das nicht sein. Denn: „Politische Börsen haben kurze Beine“, lautet eine Marktweisheit. Im Gegensatz zu Eruptionen, die der Markt selbst auslöst wie die Finanzkrise oder den Dotcomcrash, ist die Halbwertszeit politischer Krisen am Aktienmarkt eher begrenzt. Von daher lautet der Rat: Abwarten. Und später einsteigen, wenn wirklich ein Rücksetzer folgt. Am besten schrittweise.
Abwarten und Nichtstun
Bisher galt das immer als cleverste Strategie, wenn man größere Summen am Aktienmarkt unterbringen will. Denn die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen Null, als Privatanleger genau den optimalen Kaufzeitpunkt zu treffen (also die Zeit mit den tiefsten Kursen) und die Aktien auch wieder zum Indexhöchststand abzustoßen, sagen Verhaltensökonomen. Wer aber stets in Tranchen kleinere Aktienpakete kauft, der minimiere das Risiko überzogener Kurse.
Neuere Zahlen erschüttern dieses Denken ein wenig: In einer Auswertung hat der Fondsverband BVI verglichen, wie sich die Rendite von Sparplänen und Einmalanlagen in verschiedenen Fondsgattungen entwickelten – über 10 Jahre, 20 Jahre und 30 Jahre. Man würde annehmen, die Sparplansparer müssten renditemäßig die Nase vorn haben, gerade auf lange Sicht. Das Gegenteil ist der Fall.
Nur auf kurze Sicht, also für den Anlagezeitraum von 10 Jahren, hatten die Sparplananleger die Nase vorn, außer mit Immobilienfonds und internationalen Rentenfonds. In den langen Zeiträumen von 20 oder 30 Jahren schnitten die Einmalanleger dagegen deutlich besser ab. So gesehen wäre das Abwarten und Nichtstun derzeit auf jeden Fall die beste Strategie. Und wenn die Kurse sich nach unten ruckeln, kann man den Einstieg beherzt wagen und in einem Schritt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das in 10 Jahren oder gar in 20 Jahren nicht auszahlen wird, ist laut Statistik ziemlich gering. Und dann kommt ja noch der Optimismus dazu.