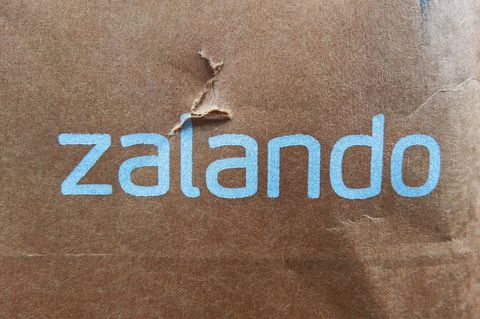15 Jahre sind vergangen, seit die beiden Gründer Robert Gentz und David Schneider begannen, Schuhe übers Internet zu verschicken. Vor zehn Jahren ging Zalando, inzwischen zum Modeversender gereift, an die Börse. Heute sei der Konzern eine „paneuropäische E-Commerce-Plattform mit 50 Millionen Kunden pro Jahr“, wie Gentz am Mittwoch im Berliner Hauptquartier erklärte. Ein echter Gigant – der aber seinen Wurzeln treu bleiben will. Was die beiden Gründer, die immer noch als Co-CEOs amtieren, damit meinen: eine unternehmerische Kultur, die Chancen ergreift, wenn sie sich bieten – auch wenn damit Risiken verbunden sind.
Konkret heißt das, dass Zalando neben dem klassischen Modeversand und dem Plattformgeschäft, über das andere Marken ihre Artikel auf Zalandos App und Website feilbieten können, nun einen dritten Businessbereich ins Visier nimmt: Es will anderen Marken und Unternehmen die eigene Software-, Service- und Logistikinfrastruktur als eigenständiges Produkt zur Verfügung stellen. Und zwar eben nicht nur wie bisher für deren Transaktionen über die Zalando-Plattform, sondern sogar für separate E-Commerce-Shops.
Im Herbst hat Zalando das Produkt namens Zeos auf den Markt gebracht, beim Termin in Berlin stellten Gentz und Schneider das Vorhaben nun ins Zentrum ihres Strategieupdates. Der Plan für das E-Commerce-Ökosystem sei „nicht nur ein anderes Wort“ als der Plattformansatz, er bedeute „neue Geschäftsgelegenheiten und höhere Ziele“, so Schneider.
Ein Strategieschwenk mit Folgen
Seit dem Launch sei man mit bereits 26 Marken bei Zeos live gegangen, hieß es am Mittwoch. In Zukunft werde man mit dem Produkt vor allem auch US-Marken ansprechen, die damit einen effizienten Zugang zum zwar großen, aber eben auch fragmentierten europäischen Markt erhalten könnten.
Auch About You, Zalandos deutlich kleinerer Konkurrent aus dem Hamburger Otto-Reich, bietet seine Shop-Software seit einigen Jahren als eigenständiges Produkt namens Scayle an – Ende Januar stand die Kundenzahl von Scayle nach Unternehmensangaben bei 140. Das Zalando-Produkt soll umfangreicher sein und eben nicht nur Software, sondern zum Beispiel auch Zugriff auf die zwölf Logistikzentren und 20 Retourenlager des Konzerns bieten.
Der Strategieschwenk bedeutet allerdings auch, dass das Unternehmen von dem Ziel abrückt, möglichst alle Transaktionen über die Zalando-Plattform abzuwickeln – man nimmt in Kauf, dass Kunden, die direkt bei anderen Marken einkaufen wollen, dies im Zweifel nicht über die App oder die Website der Berliner tun werden, sondern außerhalb der Zalando-Welt. Ein Risiko kann Gentz in dem Schritt nicht erkennen: „Wir machen den Kuchen für alle größer“, erklärte er. Es gehe darum, bei Transaktionen, die ohnehin außerhalb Zalandos passierten, in Zukunft beteiligt zu sein.
Zahl der Mitarbeiter sinkt um 1200
Schon heute erzielt Zalando etwa 900 Mio. Dollar Umsatz mit dem B2B-Geschäft. In Zukunft soll die Sparte entscheidend dazu beitragen, dass der Dax-Konzern zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren kann. Am Mittwoch wurde ein jährliches Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent bis 2028 in Aussicht gestellt. In fünf Jahren sollten dann Ebit-Margen von sechs bis acht Prozent drin sein – deutlich mehr als zuletzt.
Dass der Aktienkurs mit der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2023 teilweise um 15 Prozent in die Höhe schoss, dürfte aber weniger mit den Langfristplänen der Gründer zu tun gehabt haben, sondern mit der Einhaltung einer strikten Kostendisziplin in den vergangenen Monaten. Während die Konsumzurückhaltung den Konzernumsatz sogar leicht auf 10,1 Mrd. Euro drückte, sprang der bereinigte Betriebsgewinn von 185 auf rund 350 Mio. Euro.
Den Preis dafür bezahlte ein Teil der Zalando-Belegschaft: Laut Finanzkennzahlen wurde die Zahl der Mitarbeiter von 17.000 Ende 2022 auf unter 15.800 zu Ende 2023 gesenkt. Das Stellenabbauprogramm soll laut „Handelsblatt“ aber inzwischen beendet sein.