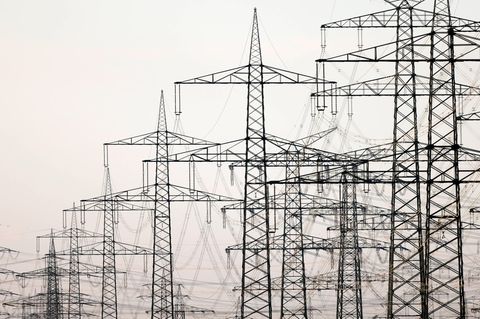Eigentlich galten alle großen Streitpunkte innerhalb der Regierungskoalition als entschieden. Noch diese Woche sollte nach der ersten Stufe des Gaspreis-Entlastungspakets auch der Entwurf für die sogenannte Preisbremse das Kabinett passieren. Doch gestern hat die Regierung den Gesetzgebungsprozess plötzlich angehalten. „Angesichts der Komplexität und auch des Abstimmungsbedarfs“ werde sich das Bundeskabinett dieser Woche wohl nicht mehr damit befassen, teilte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mit.
Vor allem über eine Frage ist offener Streit unter Experten entbrannt: Dürfen Unternehmen die Subventionen der Gaspreisbremse einfach einstreichen, auch wenn sie weniger oder gar nichts mehr produzieren? Oder dürfen sie vergünstigtes Gas sogar zu viel höheren Marktpreisen weiterverkaufen und die Staatshilfen zu Geld machen? Genau das ist im Entwurf der Expertenkommission ausdrücklich vorgesehen. Durch eine solche mögliche „Verwertung des Gaskontingents am Markt“ wollen die Fachleute einen zusätzlichen Anreiz schaffen, noch mehr als die 30 Prozent Gas einzusparen, die nicht von der Subvention des Grundkontingents gedeckt sind.
Der Gedanke, dass Konzerne Staatshilfen einfach einstreichen oder weiterverkaufen könnten, stößt manchen sauer auf. „Der Staat muss verhindern, dass er bei den Gashilfen von der Industrie ausgenommen wird wie eine Weihnachtsgans“, forderte etwa die Linke. Das gelte vor allem, wenn diese Unternehmen ihre Produktion zurückführten oder einstellten, und dadurch Arbeitsplätze verloren gingen.
„Deindustralisierung“ durch „Winterschlafprämie“
Dabei geht es aber keineswegs nur um eine Gerechtigkeitsfrage. Im schlimmsten Falle könnte dieser in der Gaspreisbremse angelegte Sparanreiz genau dazu führen, dass Unternehmen ihre Produktion einstellten oder ins Ausland verlagern, warnen die Ökonomen Sebastian Dullien und Erik Thie vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung sowie Wirtschaftsprofessorin Isabella Weber, die als eine der Erfinderinnen der Gaspreisbremse gilt. Denn die Gas-Subvention oder der durch den Weiterverkauf des Kontingents erzielbare Erlös dürfte in vielen energieintensiven Branchen größer sein, als der Gewinn aus der normalen Geschäftstätigkeit.
Sollten etwa Chemieunternehmen ihre Produktion deswegen massiv herunterfahren, um - wie Dullien, Thie und Weber warnen, „zu Gashändlern zu werden und ihr Geschäft zwischenzeitlich stillzulegen“, hätte das nicht nur für diese Firmen und deren Beschäftigte massive Auswirkungen. Es könne zu „Kaskaden-Effekten“ kommen. Das heißt, auch andere Unternehmen, die entsprechende chemische Vorprodukte benötigten, wären beeinträchtigt. Als warnendes Beispiel wird die Autoindustrie genannt, die während der Corona-Pandemie und zeitweise auch während des Ukraine-Krieges wegen des Fehlens einiger weniger Zulieferungen immer wieder lahmgelegt war.
Auch wenn manche chemische Vorprodukte aus dem Ausland bezogen werden könnten, befördere eine solche „Winterschlafprämie“ die „Deindustrialisierung“, warnen die IMK-Ökonomen. Sie fordern, dass die Gaspreisvubventionen nicht, wie es die Kommission und die Bundesregierung bislang vorsehen, unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch an die Unternehmen ausgezahlt wird, sondern immer nur für die in der Produktion eingesetzte Menge. Zustimmung bekommen die Autoren unter anderem von anderen Gewerkschafts- und SPD-nahen Kollegen. Ökonom und SPD-Vorstandsmitglied Gustav Horn schrieb auf Twitter, die Gaspreisbremse könne in ihrer aktuell geplanten Form eine „tiefe Rezession“ auslösen. Auch der Kanzler Olaf Scholz, so berichtet zumindest die „Süddeutsche Zeitung“, möchte die Gaspreisbremse entsprechend anpassen.
Andere Ökonomen, darunter die Wirtschaftsweise und Vorsitzende der Gasexpertenkommission Veronika Grimm, widersprechen und betonen die Bedeutung des Marktmechanismus, um Anreize für maximale Gaseinsparungen zu setzen. Die Produktion von günstiger importierbaren Vorprodukten einzustellen, um das Gas an anderen Stellen einzusetzen, sei gerade sinnvoll. Dies werde durch die verbrauchsunabhängige Subvention und die Handelbarkeit des Gaskontingents gefördert. Solle Gas etwa da eingespart werden, „wo es schwer ersetzbar“ ist?, fragt der Wirtschaftswissenschaftler Christian Bayer rhetorisch auf Twitter.
Alte Fronten
Mögliche Kompromisse und Alternativen gibt es: So könnte die Auszahlung der Subvention an die Bedingung geknöpft werden, Standorte und Arbeitsplätze zu erhalten, auch wenn die Produktion zeitweise ausgesetzt wird. Statt generell den Handel mit dem subventionierten Gas zu erlauben, könnte der Staat auch gezielte Rückkaufauktionen veranstalten, wenn der Energieträger tatsächlich knapp wird, das ist er derzeit schließlich noch nicht.
Doch in der Debatte unter den Ökonomen geht es um mehr. Die Fronten in dem Streit sind dieselben wie im Frühjahr, als eine große Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern in einer Studie darlegte, Deutschland käme auch ohne russisches Gas einigermaßen gut über die Runden, und damit die Forderung nach einem Gas- und Ölboykotts Russlands unterstützte. Beraten unter anderem von IMK-Chef Dullien, der für diesen Fall eine schwere Wirtschaftskrise für Deutschland prophezeite, verhinderte die Bundesregierung ein solches Embargo.
Der Kanzler kritisierte die Berechnungen der Ökonomen damals öffentlich als „unverantwortlich“. Inzwischen dürfen diese sich und ihre Modelle allerdings weitgehend bestätigt fühlen, die Industrie hat zuletzt massiv Gas eingespart, ohne dass es zu dramatischen Verwerfungen kam. Ein zentrales Element in diesen Modellen war der Ersatz energieintensiv in Deutschland hergestellter Produkte durch günstigere Importe.