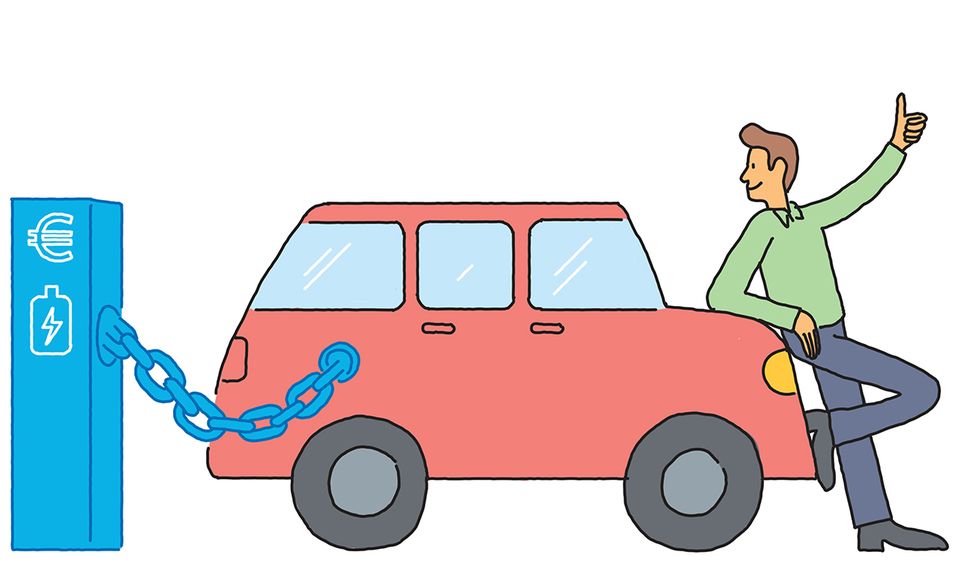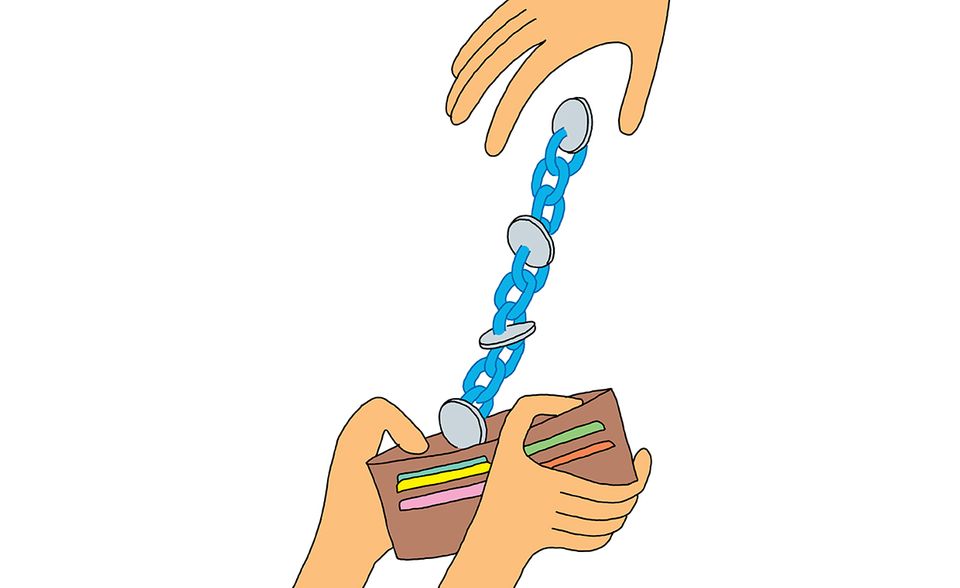Moritz von Bonin ist nicht gerade der Typ, den man sich unter einem Vertreter des mittleren Managements beim Staatskonzern Deutsche Bahn vorstellt. Gelernter Tischler, studierter Wirtschaftsingenieur, im Nebenberuf Inhaber einer Imkerei mit 26 Bienenvölkern, bei der Bahn nur auf einer Dreiviertelstelle beschäftigt.
Andererseits geht von Bonin auch keiner ganz gewöhnlichen Arbeit nach. „Head of Blockchain“ würde auf seiner Visitenkarte stehen, wenn er denn eine mitgebracht hätte zum Termin im Frankfurter Silberturm der Deutschen Bahn. Mit 25 Leuten setzt er Projekte um, in denen die Technik hinter der Kryptowährung Bitcoin dem Unternehmen helfen soll. „Wir machen Corporate Blockchain“, erklärt von Bonin in einem fensterlosen Raum im 27. Stock, auf dessen Konferenztisch sich Kabelgewirr türmt. Was heißt das denn, Herr von Bonin? „Wir schauen, wie wir mit Blockchain Prozesse besser und transparenter machen können.“
Mit Blockchain lässt sich jeder Austausch organisieren, der digital abbildbar ist
Die gehypte Technologie, die nach Ansicht ihrer Fans für die nächste digitale Revolution verantwortlich sein und so ziemlich jedes Geschäftsmodell ins Wanken bringen soll, sie wird hier auf recht banale Art eingesetzt: um Abläufe im Unternehmen zu beschleunigen. Seit Herbst 2016 beschäftigt sich von Bonins Team damit, 120 Einsatzmöglichkeiten hat es durchgespielt, eine Handvoll davon umgesetzt. Eine Anwendung im Energiebereich ist seit einem Jahr in Betrieb. So weit ist kaum ein Unternehmen in Deutschland – allein ist die Bahn mit ihren Versuchen jedoch nicht.
Während die Öffentlichkeit sich noch über die wahnwitzigen Kursausschläge von Bitcoin wundert und nicht recht weiß, wie das alles eigentlich funktioniert , hat sich die Technologie dahinter längst von ihrer prominentesten Anwendung emanzipiert. Denn per Blockchain kann man nicht nur den weitgehend reibungslosen Betrieb eines digitalen Geldsystems garantieren – mit ihr lässt sich im Prinzip jeder denkbare Austausch organisieren, der irgendwie digital abbildbar ist. Was auch bedeutet: Nicht nur Banken und Finanzdienstleister beschäftigen sich damit, sondern Unternehmen aller möglichen Branchen.
Überall im Land erproben IT-Abteilungen und Innovationslabors den Einsatz der Technologie, schieben Feldversuche und Pilotprojekte an. Unternehmen schließen sich zu Konsortien zusammen, um Standards zu vereinbaren und gemeinsame Anwendungen zu testen. Fachkonferenzen finden im Wochentakt statt. Selbst die Politik horcht auf: Sechsmal taucht der Begriff Blockchain im Koalitionsvertrag auf, hat der frisch gegründete Bundesverband Blockchain stolz mitgezählt.
Um die Ketten wird ganz schön viel Lärm gemacht. Wie weit aber ist die Revolution wirklich? Wo kann es noch hingehen? Und was genau lässt sich damit überhaupt anfangen? Zeit für eine Bestandsaufnahme.
Sicher verkettet
Einer, der mittendrin steckt und trotzdem die nötige Distanz wahren kann, ist Philipp Sandner, BWL-Professor an der Frankfurt School of Finance & Management und Leiter des dortigen Blockchain-Zentrums. „Potenzial und Verheißung sind riesig“, sagt Sandner. Aber: „Wir sind in einem frühen Test- und Experimentierstadium, es gibt viele Pläne, Ideen und Prototypen.“ Echte Anwendungen sind rar.
Dabei ist die Technik gar nicht so neu. Die erste Blockchain skizzierte 2008 der unbekannte Bitcoin-Erfinder, der sich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto verbirgt. Er wollte eine digitale Währung schaffen – aber ohne eine zentrale Aufsicht. Dabei stand er vor dem sogenannten Double-Spend-Problem: Wie stellt man ohne Zentralverwaltung sicher, dass niemand seinen Bestand vermehrt oder mehrfach ausgibt?
Die Lösung: Blockchain. Hier werden alle Transaktionen registriert, die Daten in Blöcken gebündelt und mithilfe von Verschlüsselungstechnik untrennbar miteinander verkettet. Verwahrt wird dieses Register aber nicht an einem zentralen Ort, sondern bei allen, die sich an diesem Netzwerk beteiligen. Neue Transaktionen werden einfach an die Kette angehängt und gespeichert. Vor allem aber: Vergangene Transaktionen können nicht mehr verändert werden – sie liegen sicher verpackt in den bereits gebildeten Blöcken. Damit ist die Kette praktisch immun gegen Manipulationen und Angriffe. Das ausgeklügelte System hat dazu geführt, dass die Digitalwährung Bitcoin fast ein Jahrzehnt überlebt hat. Handelsplätze mögen gehackt und leer geräumt worden sein – eine Attacke gegen den Kern des Systems, die Blockchain, ist noch nie gelungen.
Mehr als nur der Betrieb einer Währung
Früh erkannten die Krypto-Fans, dass sich mit der verteilten Datenbank mehr anstellen lässt als nur der Betrieb einer Währung. Mit dem ersten Bitcoin-Boom 2013 wuchs das Interesse auch außerhalb der Szene. Alternative Blockchains wie Ethereum entstanden, aber auch die ersten Lösungen, die sich für Unternehmen eignen: private Blockchains.
Sie lösen, auch abseits einer Währung, das Double-Spend-Problem. Wer zum Beispiel schon einmal mit mehreren Menschen an einem Word-Dokument gearbeitet hat, kennt das Problem, dass sich im virtuellen Raum Änderungen schnell überschneiden und irgendwann keiner mehr weiß, welches Dokument eigentlich das Original ist. Im simpelsten Fall dienen Blockchains daher schlicht als glaubwürdiger und ausfallsicherer Informationsspeicher in einer komplexen Umgebung – wie im Falle des ersten Projekts bei der Bahn.
Die Bahn ist einer der größten Stromverbraucher in Europa und beschäftigt darum eigene Stromhändler. Die bekamen bisher von den verschiedenen Geschäftsfeldern der Bahn den geplanten Verbrauch per Fax, Telefon und E-Mail gemeldet, mit einem Tag Vorlauf. Radikal vereinfacht wurde das über eine Blockchain-Lösung, die diese Meldungen sammelt. Die Anwender bedienen dabei ein normales Computerprogramm – viele wissen gar nicht, dass es auf einer verteilten Blockchain läuft und nicht auf einem zentralen Server. Rein technisch hätte das auf Grundlage einer normalen Datenbank gebaut werden können – der Vorteil der Blockchain-Variante aber ist die Unveränderlichkeit der Einträge. Kein Administrator kann Buchungen mehr korrigieren. Die saubere Dokumentation erfreut auch Buchhalter und Revisoren.
Fühlt sich an wie 1993
Der Aufbau der Handelsplattform war für von Bonins Team eine ungewohnte Erfahrung: „Bei einer so rohen Technologie gibt es keine Blaupausen. Alle reden immer von Prototypen, aber keiner hat etwas operativ am Laufen. Da muss man dann selber ran.“ Dabei hätten nur etwa 20 Prozent des Aufwands die Blockchain selbst betroffen, der Rest der Arbeit sei auf die Anbindung bestehender IT-Systeme entfallen. Doch sei das einmal erledigt, könnten schnell die nächsten Anwendungen folgen. „Natürlich würden wir gerne alle Prozesse durchblockchainisieren!“
Die Euphorie, die ersten Gehversuche – erfahrene Beobachter fühlen sich an die frühen Jahre des Internets erinnert. „Wir befinden uns ungefähr auf dem Niveau von 1993“, meint Alexander von Frankenberg, Chef des High-Tech Gründerfonds, Deutschlands aktivstem Wagniskapitalgeber. Die Analogie passt gut. So wie das Internet ist Blockchain eine Basistechnologie, ein Fundament, auf der andere Anwendungen erst möglich werden. Und wie vor 25 Jahren stehen erst die Grundlagen. Was mithilfe von Blockchains alles machbar sein wird, ist völlig offen. Und irre schwer vorherzusagen.
Old Economy hellwach
Auch 1993 konnte sich kaum jemand vorstellen, dass Menschen übers Netz einmal Kühlschränke bestellen, Freundschaften pflegen oder sich in die Wohnungen von Fremden einmieten würden. 1993 riet Microsoft-CEO Bill Gates seinen Leuten noch, sich um anderes zu kümmern: „Das Internet ist nur ein Hype.“
Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied: Anders als damals ist die Old Economy heute hellwach. Diese Digitalisierungswelle, so ist zu spüren, will keiner verpassen. Was neue Technologien mit dem Machtgefüge ganzer Branchen machen können, dass aus Marktführern Zwerge und aus kleinen Angreifern mächtige Plattformen werden können, das haben die Firmenlenker in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesehen. Sie sind jetzt auf der Hut. Dazu haben sie allen Grund.
Anfang April, eine Krypto-Konferenz im ehemaligen Postbahnhof am Berliner Gleisdreieck. Im Vorraum präsentieren sich Dutzende Start-ups: Blockchain-Vermögensverwalter, -Bonusprogramme, -Messenger, -Erotikanbieter und natürlich Blockchain-Unternehmensberater. Marktreife Produkte hat hier kaum einer. Üppig finanziert sind dennoch die meisten: Die Methode der Wahl sind Initial Coin Offerings, bei denen die Start-ups eigene Währungen ausgeben und dafür Geld bekommen. Selbst Start-ups, deren Geschäftsmodell nicht der Betrieb einer eigenen Währung ist, nutzen diese neuartige Form des Crowdfunding. Allein seit September wurden weltweit so etwa 11 Mrd. Dollar eingenommen. Die Stimmung ist aufgekratzt. Auf der Bühne verkündet ein Krypto-Investor mit Hipsterbrille und abgetragener Lederjacke: „Hunderte von Industrien werden disruptet werden!“
Banken adé?
Eine Woche später, ein Kongresshotel in Düsseldorf-Seestern, noch eine Blockchain-Konferenz, allerdings eine mit Dresscode – es geht deutlich gesetzter zu. Sebastian Kraft, ein junger Schlaks mit sauber gewienerten Schuhen, präsentiert die Strategie der Commerzbank. Zum Einstieg zeigt er eine Folie mit den schlingernden Umsätzen der Musikindustrie der letzten 20 Jahre. „Wir haben“, sagt Kraft, „grundsätzlich die Befürchtung, dass das den Banken auch so gehen könnte.“ Bislang traten die Institute als vertrauensstiftende Mittelsmänner bei Finanzgeschäften auf, das könnte mit der Technologie überflüssig werden.
Die Branche begegnet der Gefahr mit offenem Visier. Die Commerzbank ist etwa mit mehr als 200 weiteren Banken Mitglied des 2014 gegründeten R3-Konsortiums, das Blockchain-Software für die Finanzwelt entwickelt. Kraft sagt: „Wir sehen durchaus Chancen für uns.“ Das sind einmal die bekannten Effizienzgewinne durch schlankere Prozesse. Das kann aber auch ein reduziertes Risiko sein, wenn es bei der Ausgabe eines Wertpapiers nicht mehr zwei Tage dauert, bis das Geld auf dem Konto der Bank eingegangen ist – in der Zeit muss die Bank nämlich Eigenkapital hinterlegen.
In einem eigenen Blockchain-Labor hat die Commerzbank seit 2015 mehr als 80 Anwendungen untersucht, ein halbes Dutzend haben das Proof-of-Concept-Stadium erreicht. Ein Beispiel: Im September 2017 simulierte die Bank gemeinsam mit der KfW und der MEAG, dem Vermögensmanager von Munich Re und Ergo, eine Wertpapiertransaktion. Das von der KfW begebene Geldmarktwertpapier im Wert von 100.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Tagen wurde an die MEAG verkauft – eine vergleichsweise simple Aufgabenstellung.
Restriktive Gesetzeslage als größte Hürde
Trotzdem war das Vorgehen revolutionär: Weil Mittelsmänner wie Zahlstellen und Clearingservices damit überflüssig wurden, brauchte die Abwicklung nicht mehr zwei Tage, sondern lief quasi in Echtzeit, dazu kam die Kostenersparnis. Der Wermutstropfen: In den regulären Betrieb darf diese Anwendung noch nicht, weil die rechtlichen Voraussetzungen für eine rein digitale Abwicklung fehlen. Bei dem Test im September musste anschließend ein Notar die zuständigen Vorstände unterschreiben lassen, dann wanderte der Vertrag – wie bisher auch – als Papierdokument in den Tresor.
Die restriktive Gesetzeslage, vor allem im Finanzbereich, sieht Philipp Sandner als eine wesentliche Hürde für die Umsetzung von Blockchain-Projekten. Er glaubt deshalb auch nicht daran, dass die Banken die ersten Opfer der Krypto-Welle sein werden. „Die ersten Use-Cases werden wir in anderen Branchen sehen.“ Aber auch dort fehlten häufig die nötigen Spezialisten und in den Vorstandsetagen das nötige Verständnis. „Da muss ein kultureller Wandel stattfinden“, sagt Sandner.
„Klar ist das ein Hype – so wie der 3D-Druck“
Hamburg-Hafencity, ein weiträumiger, an drei Seiten verglaster Besprechungssaal mit spektakulärem Ausblick auf Hafen und Innenstadt. Am Kopfende des Konferenztischs nimmt Martin Kolbe Platz, Chief Information Officer von Kühne + Nagel, Spediteur mit 125 Jahren Geschichte und 76.000 Mitarbeitern, weltweite Nummer eins bei der Seefracht. Auch diese Firma würde man, bei allem Respekt, nicht unbedingt unter den Early Adoptern der Blockchain vermuten.
Kolbe nimmt dem Thema auch erst mal etwas Luft aus den Segeln: „Klar ist das ein Hype. Davon habe ich viele kommen und gehen sehen.“ Er erinnert sich gut an den letzten: 3D-Druck. „Da hieß es anfangs, dass das den Hafen überflüssig macht, weil jetzt alles in Hamburg gedruckt wird.“ Es kam dann nicht ganz so.
Shit in, shit out
„Wir sehen das als ein Technologiethema unter vielen“, sagt Kolbe. „Aber eines, das man auch beherrschen muss.“ Es ist ein weiteres Werkzeug im Technikbaukasten, hilfreich bei der Mammutaufgabe der Digitalisierung, die die Spediteure überwiegend noch vor sich haben. Es fängt damit an, dass in der Branche kaum gemeinsame Standards existieren, auf deren Grundlage man digitale Plattformen bauen könnte, etwa zum Verfolgen von Containern über mehrere Beteiligte einer Lieferkette. „Man denkt“, sagt Kolbe, „der Container ist ein hoch standardisiertes Industriegut, auf den Millimeter genormt, da müsste auch der Umgang damit standardisiert sein. Ist er aber nicht.“
Seit 2016 beschäftigt sich die IT von Kühne + Nagel mit Blockchains, man schaute nach möglichen Partnern, sondierte Anwendungspotenziale. Schließlich wurde als geeigneter Problemfall ein altertümliches Dokument identifiziert: der Frachtbrief. Er begleitet, im Original natürlich, jede Sendung, er wird an jeder Station gestempelt, dient als Sicherheit für Banken und kann, wenn er irgendwo aufgehalten wird, ein Schiff tagelang an den Hafen fesseln.
Gemeinsam mit Partnern entwickelte Kühne + Nagel einen Blockchain-Ersatz für das Dokument. Im Frühjahr absolvieren die ersten Sendungen die komplizierte Lieferkette – fast 20 Stationen sind es insgesamt. Alle sind an das System angebunden, „stempeln“ digital den Frachtbrief, jeder der Beteiligten kann jederzeit sehen, wo die Sendung gerade ist und welchen Status sie hat.
Im Moment baut das Konsortium einen Prototyp der Lösung, bis Jahresende soll er fertig sein. Daneben wird versucht, die Gruppe zu erweitern – schließlich macht eine solche Plattform umso mehr Sinn, je mehr Unternehmen daran teilnehmen. Auch Mitbewerber von Kühne + Nagel sollen sich beteiligen können.
Stufe 2: vollautomatische Verträge
Und es geht schon jetzt um weitere Funktionen. Etwa sogenannte Smart Contracts, die zweite Ausbaustufe der Blockchains: vollautomatische Verträge, die bei bestimmten Ereignissen in Kraft treten. Im Fall des digitalen Frachtbriefs hieße das zum Beispiel, dass mit der Anlandung eines Containers automatisch ein Trucker angeheuert wird, der die Sendung weitertransportiert. Noch aber ist das Zukunftsmusik. (Genauso übrigens wie die dritte Ausbaustufe, sogenannte dezentrale autonome Organisationen – Unternehmen oder Institutionen, die nur noch in der Blockchain existieren oder funktionieren.)
Kolbe macht sich stattdessen Gedanken über ein Dilemma, das in der Begeisterung über die neue Technik bisweilen übersehen wird. In der IT-Welt heißt das Problem einprägsam: „Shit in, shit out“. Daten werden durch Blockchains zwar unverfälscht und unveränderbar weitergegeben – bloß eine Garantie, dass die Daten bei der Eingabe valide und richtig sind, gibt es nicht. „Wenn uns Daten fehlen, wenn wir falsche oder fragmentierte Daten haben, dann müssen wir nach wie vor nach anderen Verfahren suchen, um das zu verbessern“, sagt Kolbe. Kühne + Nagel setzt dafür auf Massen von Sensoren, auf Containerwaagen – auf Schnittstellen mit der Realität, die in der Summe verlässlicher sein sollen. Denn die Blockchain mag eine vielversprechende Technik sein. Der Mensch aber bleibt eine Fehlerquelle.
Dieser Beitrag ist erstmals 2018 in Capital erschienen.