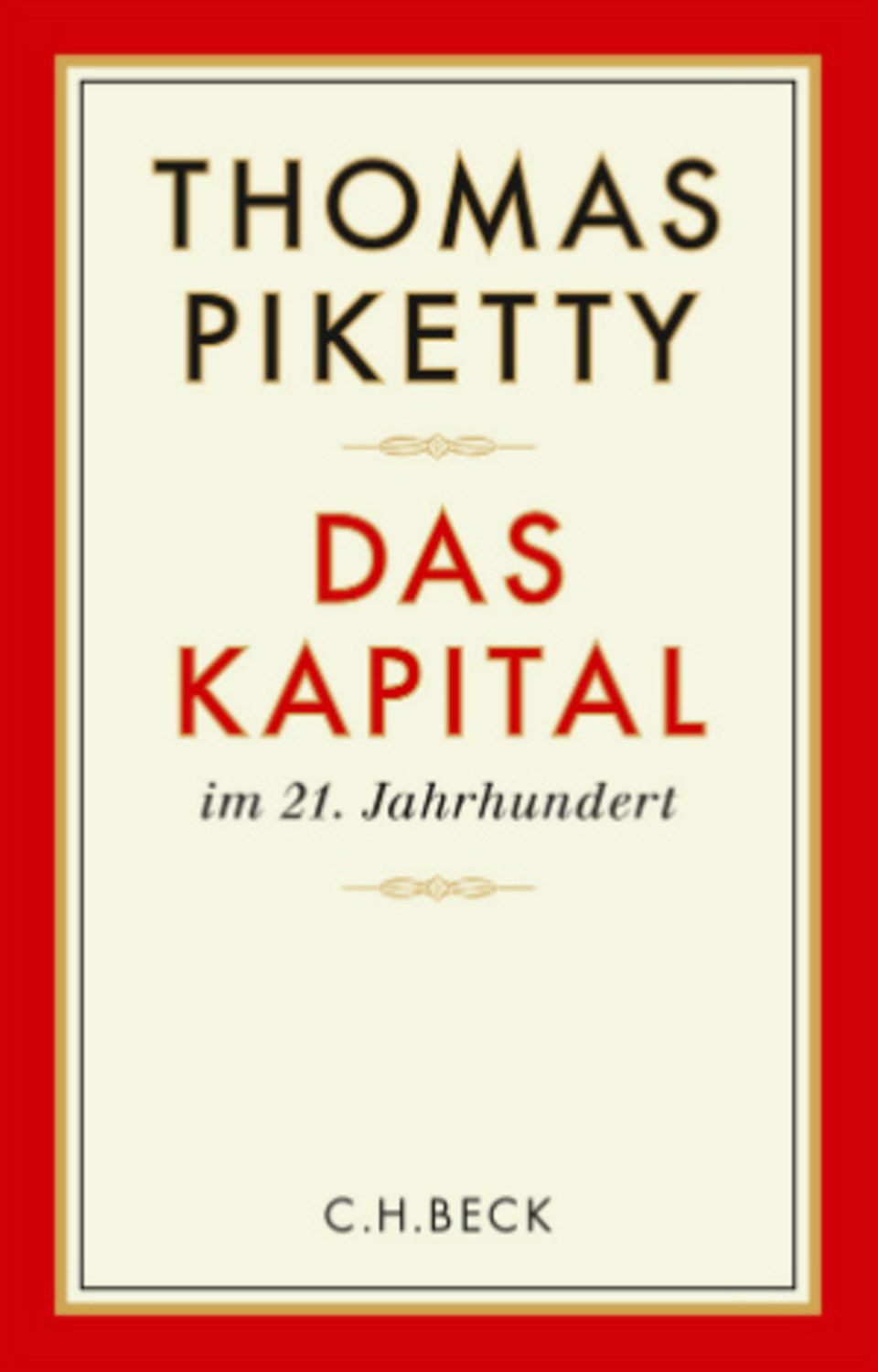Till van Treeck ist Professor für Sozialökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Zurzeit forscht er gemeinsam mit Kollegen in einem vom Institute for New Economic Thinking (INET) geförderten Projekt zum Zusammenhang zwischen steigender Einkommensungleichheit und makroökonomischer Instabilität
In diesen Tagen erscheint er endlich auch auf Deutsch: Thomas Pikettys internationaler Bestseller mit dem monumentalen Titel „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. Die im April veröffentlichte englische Übersetzung des ursprünglich auf Französisch geschriebenen, beinahe 1000 Seiten starken Wälzers hat erstaunliche Wellen geschlagen. Beinahe alles, was in der internationalen Ökonomen-Szene Rang und Namen hat, hat mittlerweile Position bezogen zu den von Piketty erarbeiteten Thesen. Zeitweise führte das Buch sogar die Verkaufslisten von Amazon an, höchst ungewöhnlich für einen wissenschaftlichen Fachtitel.
Die Faszination für Pikettys Werk liegt begründet in der Kombination aus umfangreichem empirischen Datenmaterial und dessen Interpretation auf Basis von „fundamentalen Gesetzen des Kapitalismus“. Vor allem letztere (und natürlich die Wahl des Buchtitels) haben Piketty in den Feuilletons den Ruf eines neuen Karl Marx eingebracht.
Im beschreibenden Teil seines Buches weist Piketty auf drei Phänomene hin, die alle einen Anstieg der ökonomischen Ungleichheit signalisieren. Erstens ist in vielen Ländern seit Anfang der 1980er Jahre der Anteil der Spitzeneinkommen an den gesamten Haushaltseinkommen (Top Income Shares) stark gestiegen. Dieser Anstieg war in den USA deutlich stärker als in Europa. Zweitens hat auch der Anteil der hohen Vermögen an den gesamten Vermögen vielerorts zugenommen, wenn auch langsamer als der Anstieg der Einkommensungleichheit. Und drittens haben sich die Vermögen insgesamt schneller entwickelt als die Einkommen, was ebenfalls auf eine höhere Ungleichheit hindeutet, weil die Vermögen stärker konzentriert sind als die Einkommen. Diese Entwicklung wiederum war in Europa stärker ausgeprägt als in den USA, vor allem weil in Europa das Einkommenswachstum schwächer war als in den USA. Hiermit geht auch eine zunehmende Bedeutung von Erbschaften einher. Immer mehr Erben erzielen ohne eigene Leistung so hohe Einkommen, wie sie normale Arbeitnehmer während ihres ganzen Lebens nicht erreichen.
Das Neue an Pikettys Zahlen ist dabei, dass sie auf amtlichen Einkommen- und Vermögensteuerstatistiken basieren, und nicht, wie in früherer Forschung üblich, auf freiwilligen Haushaltsbefragungen. Letztere unterschätzen typischerweise die Ungleichheit am oberen Ende der Verteilung, weil einkommensstarke und vermögende Haushalte nur ungerne Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse geben. Zudem legt Piketty für eine Reihe von Ländern lange Zeitreihen für mehrere Jahrhunderte vor, was die Analyse langfristiger Trends ermöglicht.
Pikettys Provokation
Die „fundamentalen Gesetze des Kapitalismus“, mit Hilfe derer Piketty seine Daten interpretiert, bestehen zunächst einmal aus elementaren definitorischen bzw. arithmetischen Zusammenhängen, die niemand ernsthaft anzweifeln würde. Ihre Brisanz gewinnen sie erst aus zusätzlichen empirischen Beobachtungen. Zum einen argumentiert Piketty, dass die Kapitalrendite, r, im Kapitalismus typischerweise oberhalb der Wachstumsrate der gesamtwirtschaftlichen Einkommen, g, liege. Aus r>g folgt jedoch unter bestimmten weiteren Annahmen, dass die Kapitaleinkommen schneller steigen als die Arbeitseinkommen. Piketty sieht daher die Gefahr, dass sich die in den letzten Jahrzehnten gestiegene Ungleichheit zwischen Vermögenden und Normalbevölkerung in Zukunft noch weiter verschärft.
Dass Piketty die Tendenz zu steigender ökonomischer Ungleichheit ausgerechnet aus der Formel r>g ableitet, kann aus Sicht der neoklassischen Orthodoxie nur als Provokation aufgefasst werden. Denn, wie etwa Karl-Heinz Paqué jüngst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte:
„In der volkswirtschaftlichen Wachstumstheorie ist r>g keine Zauberformel, sondern eine fast selbstverständliche Annahme: In einer Welt, in der Menschen ungeduldig sind und lieber heute als morgen die Früchte ihrer Leistung konsumieren statt zu sparen, müssen sie von Investoren für ihren Verzicht entschädigt werden, und zwar über die reine Zuwachsrate der Wertschöpfung hinaus.“
Der entscheidende Denkfehler orthodoxer neoklassischer Ökonomen besteht nun freilich darin, dass sie das Sparverhalten von Individuen in erster Linie aus deren Zeitpräferenzen (geduldige Sparer, ungeduldige Kreditnehmer) bzw. der Position im Lebenszyklus (Vermögensaufbau in der Erwerbsphase, Vermögensabbau im Alter) zu erklären versuchen.
Bedeutung unterschiedlicher Sparquoten
Gegen diese Weltfremdheit vieler Ökonomen schreibt Piketty an. Denn sowohl der gesunde Menschenverstand als auch empirische Arbeiten zeigen, dass Personen mit relativ hohen Einkommen systematisch einen höheren Anteil ihres Einkommens sparen als Personen mit relativ niedrigen Einkommen. Und weil dies über den gesamten Lebensverlauf gilt, vererben Personen mit relativ hohen Lebenseinkommen auch proportional mehr an ihre Nachkommen als Personen mit relativ niedrigen Lebenseinkommen. Dies ist ganz einfach so, weil es sich eben nicht jeder leisten kann, einen großen Teil seines Einkommens auf die hohe Kante zu legen. Wer nicht gerade oben in der Einkommenshierarchie steht, hat nun einmal andere Sorgen, als auch noch für die Zeit nach dem eigenen Ableben ein Vermögen für die Hinterbliebenen anzuhäufen.
Die langfristige Entwicklung der Einkommens- und Vermögensungleichheit hängt daher im Wesentlichen von drei Faktoren ab: die Spreizung der Arbeitseinkommen, das Verhältnis von r und g, und die Unterschiede in den Sparquoten zwischen den Haushalten. Leider hat sich die bisherige Debatte um „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ fast ausschließlich um das Verhältnis von r und g gedreht, während die Bedeutung unterschiedlicher Sparquoten unterbelichtet geblieben ist.
Wenn die Sparquoten unabhängig vom relativen Einkommen wären, dann wäre auch das Verhältnis von Vermögen zu Einkommen für die einzelnen Haushalte unabhängig vom jeweiligen Einkommen, so dass über alle Einkommensgruppen hinweg das Verhältnis von Kapital- und Arbeitseinkommen gleich wäre. Somit wäre langfristig die Vermögens- und Einkommensverteilung identisch mit der Lohnverteilung, und das Verhältnis von r und g wäre irrelevant für die Verteilungsentwicklung.
Vermögende profitieren vom schwachen Wachstum
Wenn hingegen die oberen Einkommensgruppen höhere Sparquoten haben als die unteren Einkommensgruppen, sind die Einkommen langfristig ungleicher verteilt als die Löhne, weil die Vermögen und Kapitaleinkommen ungleicher verteilt sind. Wie stark diese Dynamik ist, hängt nicht alleine vom Verhältnis zwischen r und g ab, sondern zentral von der Diskrepanz zwischen den Sparquoten von reicheren und ärmeren Haushalten. Das ist die zentrale Ungleichheitsfeder im Kapitalismus: Weil die Reichen reich sind, können sie mehr sparen als arme Haushalte, und deswegen bilden sie höhere Vermögen, erzielen höhere Kapitaleinkommen, können noch mehr sparen und so weiter. Hinzu kommt, dass Reiche in der Regel höhere Renditen auf ihr Vermögen erzielen, weil sie ihr Portfolio besser diversifizieren und risikofreudiger sein können. Je höher außerdem die Rendite auf Vermögen, und je geringer das Wirtschaftswachstum, desto leichter fällt es den reichen Haushalten, ihre relative Vermögensposition weiter zu verbessern und zu vererben.
Vieles spricht nun in der Tat dafür, dass die Wachstumsraten in den entwickelten Volkswirtschaften in absehbarer Zukunft schwach ausfallen werden, und zwar nicht nur wegen der zu erwartenden demographischen Entwicklung: In vielen Ländern sind die Privathaushalte überschuldet, und die Regierungen sind auf eine anhaltende Sparpolitik eingestellt. In diesem Umfeld überrascht es nicht, dass die Investitionsneigung der Unternehmen schwach ist. Viele Beobachter sprechen von der Gefahr einer säkularen Stagnation mit geringem Wachstum und hoher Arbeitslosigkeit. All dies spricht nicht für eine baldige Reduktion der Ungleichheit.
Hinzu kommt, dass sich die Sparquoten einkommensstarker und einkommensschwacher Haushalte in den letzten Jahrzehnten vielerorts weiter auseinander entwickelt zu haben. In den USA und anderen angelsächsischen Ländern reduzierten alle Haushalte unterhalb der Spitzenverdiener ihre Ersparnisse (und erhöhten ihre Verschuldung), um trotz geringerer (relativer) Einkommen den Rückgang ihres (relativen) Lebensstandards in Grenzen zu halten. Angesichts steigender Kosten für grundlegende Bedürfnisse wie Bildung oder das Wohnen in „guten Gegenden“ konnten viele US-Amerikaner notwendige Ausgaben über eine reduzierte Ersparnis und höhere Kredite finanzieren. Zusätzliche Anreize hierfür schafften die Deregulierung der Kreditmärkte und die politisch motivierte Förderung von Wohnungsbaukrediten.
Überschuldung von Privathaushalten belastet Wachstum
Der Beginn dieses kreditfinanzierten Konsummodells der US-amerikanischen Mittelschicht fällt genau zusammen mit dem rasanten Anstieg der Einkommensungleichheit am oberen Ende der Verteilung seit den frühen 1980er Jahren, den Pikettys Top-Einkommens-Daten so eindrucksvoll zeigen. Eine Zeit lang sah es so aus, als könnte auch die Mittelschicht selbst ohne laufende Ersparnis Vermögen bilden, weil die Häuserpreise stetig zu steigen schienen. Doch diese Illusion ist spätestens seit dem Platzen der Immobilienblasen nach 2007 vorbei. Was bleibt, ist eine bei den reichen Haushalten und im Ausland verschuldete Mittelschicht und eine gestiegene Vermögensungleichheit, die nach und nach verstärkend auch auf die Einkommensungleichheit zurückwirken wird.
Gleichzeitig ist die Überschuldung der Privathaushalte eine schwere Hypothek für die künftige Wachstumsentwicklung in den USA. Nachdem jahrzehntelang fehlende Einkommenssteigerungen der Mittelschicht durch Kredite ersetzt wurden und so der Konsum hochgehalten wurde, droht nun die säkulare Stagnation nicht zuletzt deswegen, weil bei sich weiter verschärfender Ungleichheit aber erschöpften Verschuldungsmöglichkeiten die Konsumnachfrage nicht in Gang kommt.
In Deutschland reduzierte die Mittelschicht nicht ihre Ersparnisbildung und sie verschuldete sich auch nicht zunehmend, als zu Beginn der 2000er-Jahre die Einkommensungleichheit rasant anzusteigen begann. Dies dürfte mit anderen sozialen Normen zusammenhängen und mit der weniger laxen Kreditvergabe der Banken im Vergleich etwa mit den USA. Dennoch entwickelte sich die relative Ersparnisbildung von arm und reich auseinander: Hierzulande waren es die Unternehmen, die in den frühen 2000er Jahren begannen, im Zuge stark steigender Gewinne vermehrt Geldvermögen zu bilden. Weil die Unternehmen ihre Einnahmen nicht an den privaten Haushaltssektor weitergaben, stiegen zwar die Top-Haushaltseinkommen viel weniger stark an als etwa in den USA, wo die Unternehmen viel aggressiver auf Gewinnausschüttungen für die Aktionäre und Bonuszahlungen für die Spitzenmanager setzten. Die einbehaltenen Unternehmensgewinne bleiben zwar in Pikettys Top Income Shares unberücksichtigt, ihr Anstieg bedeutet aber eine Zunahme der Ungleichheit, weil die Letzteigentümer der Unternehmen in erster Linie reiche Haushalte sind. Und spätestens mit dem Ableben der Baby-Boomer, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, wird die Vererbung von in Unternehmen angehäuften Vermögen zum ernsthaften Verteilungsproblem werden, vor allem wenn die angemessene Besteuerung dieser Vermögen weiterhin ein politisches Tabu bleibt.
Einkommen der großen Masse muss Schritt halten
Die anhaltend hohen Finanzierungsüberschüsse des Unternehmenssektors bedeuten aber nicht nur, dass sich die Ersparnisbildung von reich und arm auseinanderentwickelt, sondern sie sind auch ein schwerwiegendes makroökonomisches Problem. Die privaten Haushalte waren in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland immer Nettosparer. Der Staat darf sich wegen der sogenannten Schuldenbremse nicht mehr neu verschulden. Wenn nun auch noch die Unternehmen angesichts hoher Gewinne nicht mehr auf eine für diesen Sektor eigentlich übliche Nettokreditaufnahme angewiesen sind, bedeutet dies, dass die deutsche Volkswirtschaft strukturell weniger ausgibt, als sie einnimmt, also Leistungsbilanzüberschüsse realisiert. Damit trägt Deutschland maßgeblich zur Nachfrageschwäche in Europa und weltweit bei, welche sich zu der besagten säkularen Stagnation zu verfestigen droht.
Das sollte die zentrale Lehre sein, die die Volkswirtschaftslehre und die Wirtschaftspolitik aus der Weltwirtschaftskrise 2007ff. ziehen sollte: Der Kapitalismus kann auf Dauer nur stabil sein, wenn die Einkommen der großen Masse der Bevölkerung im Gleichschritt mit der Güterproduktion steigen. Wenn dies nicht der Fall ist, droht längerfristig Instabilität: entweder weil die Mittelschicht wie in den USA nur noch kreditfinanziert konsumieren kann und früher oder später überschuldet ist; oder weil wie in Deutschland die Binnennachfrage schwächelt und Wachstum und Beschäftigung nur noch über die kreditfinanzierte Nachfrage des Auslands erzeugt werden können. Die zunehmende Ungleichheit, die Piketty in „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ so faktenreich analysiert, und die schwere Krise des Kapitalismus im frühen 21. Jahrhundert sind untrennbar miteinander verbunden.
Starthilfe für Debatte über Vermögensverteilung
Dass dabei gerade auch in Deutschland eine bessere Lohnentwicklung und eine gleichmäßigere Einkommensverteilung makroökonomisch stabilisierend wirken könnten, wird glücklicherweise von immer mehr wirtschaftspolitischen Akteuren diskutiert. Allerdings schreitet das Umdenken hierzulande nur langsam voran: Bekanntermaßen stoßen Verteilungsfragen unter deutschen Ökonomen nicht auf besonderes Interesse. Dies zeigt auch die erste Rezeption von Pikettys „Das Kapital im 21. Jahrhundert“.
Dennoch bleibt zu hoffen, dass „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ die politische Debatte zur sozialen Ungleichheit in Deutschland beleben wird. Dies gilt insbesondere für die dringend notwendige Verbesserung der Datenlage zu Einkommens- und Vermögensverteilung. Mancher Leser dürfte etwa überrascht darüber sein, in Pikettys Buch keine langen Zeitreihen zur Verteilung der Vermögen für Deutschland zu finden. Das liegt zum einen daran, dass es in Deutschland keine Vermögensteuer gibt, anders als etwa in Frankreich, wo seit der Französischen Revolution von 1789 die Verteilung der Vermögen von Amts wegen erfasst wird. Doch überhaupt steht die Forschung zur Vermögensungleichheit in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Das Sozioökonomische Panel (SOEP) befragt die Haushalte erst seit 2002 zu ihren Vermögensverhältnissen, sehr reiche Personen beteiligen sich hieran jedoch kaum. Und auch die Erfassung sehr hoher Einkommen wird seit 2009 durch die sogenannte Abgeltungssteuer erschwert, die als Quellensteuer nicht mehr personenbezogen erfasst wird, sondern direkt von den Finanzinstituten anonym abgeführt wird. Mithin wird durch die vorhandenen Daten die Einkommens- und Vermögensungleichheit in Deutschland tendenziell unterschätzt.
Das Mindeste, das die deutsche Politik von Thomas Pikettys Bestseller lernen kann, ist daher, dass eine demokratische Gesellschaft halbwegs genau wissen sollte, wie Einkommen und Vermögen verteilt sind. Und dass es Ökonomen braucht, die Verteilungsfragen überhaupt zu stellen bereit sind. Für diese notwendige Debatte ist „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ eine wertvolle Starthilfe.