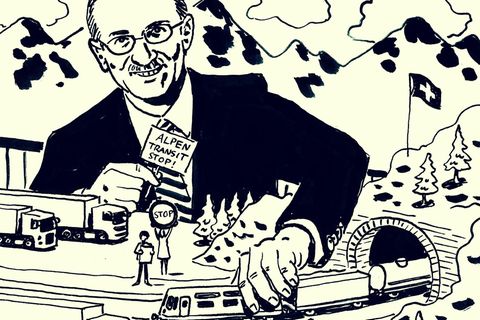Sie heißen Truck-Pilot, Bertha oder Newton und sind äußerlich von anderen Brummis kaum zu unterscheiden. Sie nehmen den Kreisverkehr auf einem Hafengelände, parken punktgenau neben Schienensträngen, um Container zu laden, und wagen sich zu Testfahrten auf die Autobahn – ganz oder weitgehend autonom. Selbstfahrende Sattelschlepper, ausgerüstet mit Kameras, Sensoren, Radar und einem Hirn voll künstlicher Intelligenz, überholen gerade die Prognosen, die ihre Hersteller noch selbst vor kurzem aufgestellt hatten.
In einem Umschlagterminal der Deutschen Bahn lädt ein intelligenter MAN-Truck bereits im Alltagsbetrieb Container vom Güterzug auf Lkw. Das Automatisierungsprojekt Anita zeigte im Frühsommer auf einer Teststrecke in München dem Publikum, wie die Fühler im Führerhaus Hindernisse erkennen – und mit tückischen Spiegelungen auf nassem Asphalt zurechtkommen. Nun gingen die fahrerlosen Tests in Ulm in die entscheidende Phase über, so MAN-Forschungsvorstand Frederik Zohm: die der praktischen Feinabstimmung für Augen und Ohren.
Weiter nördlich pendeln zwischen dem Container-Terminal Soltau und dem Hamburger Hafen seit Juli 2020 automatisierte Trucks. Auf 70 Kilometern entlang der A7 sitzt der Fahrer einer Emdener Spedition am Steuer; dabei wurden Daten gesammelt für das spätere autonome Fahren. Am Check-in des Hafengeländes macht er einem Sicherheitsfahrer Platz – für das Stand-by. Sein Ziel am 1400 Meter langen Blocklager am Ballinkai steuert der Truck-Pilot eigenständig an, rangiert rückwärts in seine Parkposition und signalisiert: Container fertig zum Abladen.
Ein drittes Projekt testet „Automatisierten Transport zwischen Logistikzentren auf Schnellstraßen“: An Atlas-L4 zum Einsatz von fahrerlosen Trucks auf der Autobahn sind neben MAN drei Zulieferer, zwei Tech-Firmen, drei wissenschaftliche Einrichtungen und der TÜV-Süd beteiligt. Erklärte Absicht: bis Mitte des Jahrzehnts ein auf die Industrialisierung übertragbares innovatives Logistik-Konzept für den Betrieb automatisierter Lkw auf der Autobahn zu haben.
Bald Realität auf deutschen Straßen?
Nur: Ist das noch Utopie, hehre Zukunftsträume, oder sind Robo-Trucks schon bald natürliche Verkehrsteilnehmer auf deutschen Straßen? Sicher ist: Der Druck in der Branche nimmt zu, denn das Frachtaufkommen steigt ebenso wie der akute Mangel an Lastkraftfahrern. Experten sehen die Branche daher zum Sprung ansetzen: „Ich gehe stark davon aus, dass selbstfahrende Trucks in zwei bis drei Jahren in Betrieb gehen“, sagt Andreas Herzig, der bei der Beratungsfirma Deloitte im Bereich Automotive für künstliche Intelligenz zuständig ist. Womöglich seien die USA schneller; „aber auch in Europa werden verpartnerte Logistiker und Hersteller über Pilotprojekte hinaus und auf die Straße kommen“.
Bei beiden hat der Experte in den vergangenen zwei Jahren stark zunehmende Aktivitäten festgestellt. Deutsche Lkw-Bauer seien dabei in Kooperation mit spezialisierten Techunternehmen führend in der Entwicklung und kapitalstark. Herzig: „Ich würde sagen, sie sind in der Phase des Anlaufs.“
Was nicht heißt, dass die Ampel bereits auf grün steht. „Für das wirklich autonome Fahren in allen Verkehrssituationen wird man aus Sicherheitsgründen bei Lkw länger brauchen als bei Pkw“, dämpft Hartmut Güthner, Experte für autonomes Fahren, die Erwartungen. Ein Problem etwa ist der Rundumblick von Sattelschleppern mit wechselnden Ladungen. Abseits einfacher Wege explodiert die Komplexität der von Bordrechnern zu verarbeitenden Informationen. „Aber Hub-to-Hub-Konzepte sind schon heute realisierbar“, sagt Güthner, Direktor bei der Beratungsfirma Strategy& vom Netzwerk PwC. „Wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen es zulassen, wird man bis zum Jahr 2025 in der Lage sein, Hub-to-Hub-Konzepte zu bedienen.“ Will heißen: Pendelverkehr auf einfachen Distanzen, wie zwischen Logistikzentren, die in direkter Nähe zu Autobahnen verbreitet sind.
Wie steht es also um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Staus verursachen in Deutschland jedes Jahr volkswirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe, Verkehrsunfälle gehen zu rund 90 Prozent auf menschliches Versagen zurück, Fahrermangel hemmt das Unternehmenswachstum. Von mindestens 60.000 fehlenden Berufskraftfahrern spricht der Branchenverband, bei rund 17.000 Berufs- und etwa 30.000 Renteneinsteigern. Tendenz steigend. Der Frachttransport wird voraussichtlich von 17,4 Milliarden Tonnen 2015 auf 25,5 Milliarden Tonnen 2045 wachsen.
Ein selbstfahrendes Zuglastersystem erfordere für die Entwicklung bis zur Qualifizierung Investitionen in einer Größenordnung von 250 Mio. bis 1 Mrd. Euro, schätzt Güthner. Fördermittel vom Bund bewegen sich im einstelligen Millionenbereich. Für den KI-fähigen Aus- und Umbau von Betriebshöfen, Umschlagplätzen oder Logistikzentren müssten die Betreiber aufkommen. Um Autobahnen für das hochautomatisierte Fahren fit zu machen – etwa mit der Aufstellung von Signalposten an genehmigten Strecken – müsste der Bund in die Spur kommen. Entscheidend für eine Serienfertigung ist aber ein wirtschaftlicher Betrieb.
Gamechanger in Sicht
Und hier sind die Anreize für den Straßengüterverkehr merklich höher als bei Pkw. Für teurere, halbautonome Autos mit einem Highway-Pilot werden sich vor allem technikinteressierte und statusbewusste Fahrer begeistern, meint Deloitte-Experte Herzig. Bei Nutzfahrzeugen gebe es dagegen „einen glasklaren Business Case: deutlich gesteigerte Effizienz und weniger Kosten“. Denn die Fahrzeuge könnten in den jeweils zulässigen Fahrsituationen ohne Pausen und ohne Fahrer unterwegs sein. Gleichmäßig verteilt auf 24 Stunden an sieben Tagen, entlaste das auch die Straßen und die Infrastruktur.
Strategy&-Experte Güthner schätzt, dass ein automatisiertes Zugfahrzeug in der Anschaffung mit etwa 10 bis 15 Prozent nur unwesentlich teurer wäre. „Man spricht von Mehrkosten im Umfang von 10.000 bis 15.000 Euro, mit sinkender Tendenz auf etwa die Hälfte bis 2030.“ Der wesentliche Vorteil: Die Logistikbranche könnte zwischen den Hubs bis zu 40 Prozent Betriebskosten einsparen, wenn der Fahrer wegfällt. „Wer zuerst eine gute technische Lösung an den Start bringt, wird zum Gamechanger – die Lösung wird vermutlich reißende Abnehmer finden“, sagt er. Der Druck in der Branche sei so groß. „Es winkt ein Riesengeschäft.“
Da für das autonome Fahren zunächst nur bestimmte Verkehrsbereiche freigegeben werden – zum Beispiel Autobahnen –, hält auch Deloitte-Mann Herzig es für lohnenswert, eigene Knotenpunkte oder Hubs in der Nähe einzurichten. Die Hubs stellen die Übergabepunkte zwischen automatisierten Schwerfahrzeugen und kleineren Transportern mit Fahrern dar, die den Staffellauf in Wohn- und Gewerbegebiete übernehmen. Die Rechenleistung, die in solcher Umgebung – für die enorme Zahl an Datenverarbeitungsschritten bei gleichzeitig sehr kurzer Reaktionszeit – erforderlich wäre, könnten die derzeit in Testfahrzeugen verbauten Rechner noch gar nicht darstellen.
Gesetz ebnet den Weg
Mit seinem 2021 verabschiedeten Gesetz zum autonomen Fahren nimmt Deutschland eine Pionierrolle ein, sagen Experten. Versuchsmodelle, die Erfahrungen mit Risiken und Nebenwirkungen sammeln, sind bislang mit Sonderzulassungen unterwegs. So lernt die KI dazu. Zudem plant die EU in den nächsten zwei Jahren, den Betreibern von KI-Systemen für eine Reihe von Risikoklassen ein permanentes Monitoring vorzuschreiben, auch für Pilotprojekte. Seit diesem Jahr ist auch Cybersicherheit zulassungsrelevant: Ein Fahrzeug muss so sicher sein, dass Hacker es nicht kapern und fernsteuern können.
Laut gesetzlichen Bestimmungen dürfen Lkw mit Fahrassistenz bereits jetzt in bestimmten Situationen autonom fahren – zum Beispiel bis zu 60 Stundenkilometer auf deutschen Autobahnen und mit einem Fahrer an Bord, der aufpasst und notfalls einspringt. Das Limit werde der Gesetzgeber in den kommenden ein bis zwei Jahren auf 130 Stundenkilometer auf deutschen Autobahnen erhöhen, erwartet Deloitte-Experte Herzig. Dann sprechen wir von „freier Fahrt“ auf zugelassenen Distanzen. Unter die im Gesetz genannten „festgelegten Betriebsbereiche“ fielen auch Strecken zwischen Logistikknotenpunkten. Zulassungen für den Betrieb von automatisierten Fahrzeugen – mit Sicherheitsfahrer oder Remote-Pilot oder ohne – müssten wohl einzeln von den Landratsämtern erfolgen.
Nach und nach werden sich so wohl unmerklich automatisierte Neufahrzeuge unter die rollende Brummi-Flotte mischen. Neben dem Nürnberger Hersteller MAN, der zur Volkswagen-Tochter Traton gehört, hat Daimler Trucks sich zum Ziel gesetzt, selbstfahrende Lkw in Serie zur produzieren – bis Ende des Jahrzehnts. Vor allem in den USA, aber zuletzt auch in Stuttgart, entwickelt Daimler mit der Tech-Tochter Torc und dem erfahrenen strategischen Partner Waymo Robo-Trucks für die Langstrecke. In den USA fehlten 2021 rund 30.000 Trucker.
Dem schwedischen Hersteller Scania haben die Behörden in diesem Jahr erlaubt, den Radius selbstfahrender Testfahrzeuge (mit Sicherheitsfahrer) von 70 Kilometern auf der Autobahn auf 300 Kilometer vom Werkstor in Södertälje zur 300 Kilometer entfernten Stadt Jönköping auszudehnen – auf Schnell- und Landstraßen. Volvo Autonomous Solutions (VAS) gab im Mai bekannt, man werde mit dem Logistikkonzern DHL in den USA eine Hub-to-Hub-Lösung pilotieren. Volvo entwickelt auch einen elektrischen Sattelschlepper. Elektrisch tritt auch der schwedische Hersteller Einride derzeit in Deutschland an – er will mit einem futuristisch anmutenden Pod-Truck ohne Führerhaus am automatisierten Markt mitmischen.
Im dreijährigen MAN-Projekt mit der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat der Truck-Pilot die Tests jedenfalls bestanden, so das Unternehmen. Die Logistiker erprobten die Integration in die hochautomatisierten Umschlagprozesse. Ganz ohne Zutun eines Fahrers klappt das vorerst trotzdem nicht: Noch muss ein Fahrer aussteigen, eine Twistlocks-Verriegelung öffnen und dies an einem Kartenlese-Gerät bestätigen, damit der Container automatisch abgeladen werden kann. Aber das gehört dann wohl zum Fine-Tuning.