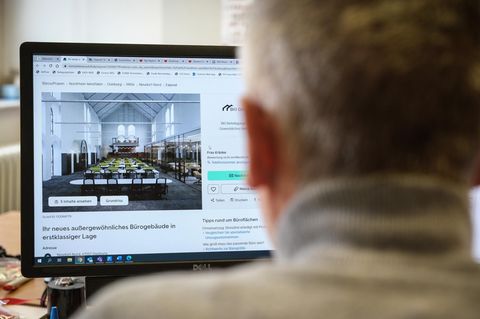Beschleunigen kann der neue Porsche Taycan GT wie kein anderes elektrisches Auto eines Großserienherstellers. In 2,2 Sekunden ist der Sportwagen in seiner schnellsten Version auf 100 Stundenkilometer, in 6,4 Sekunden auf 200. Wer das mitmachen will, muss sich mit Helm und Kragenstabilisator rüsten, dann rast das in der Spitze 1108 PS starke Auto schneller los, als dass Hirn und Magen mitvollziehen können, was geschieht. Jedenfalls scheint ein Großteil der Teststrecke am Werksgelände in Leipzig mit dem Zucken eines Augenlids verschwunden. Der 80-jährige Familienpatriarch und Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche wird wie ein alter König am Firmenstandort in Leipzig empfangen, um der Präsentation des neuen Autos seinen Segen zu geben. Im von Macht und Repräsentanz geprägten Reich um die Familien und Konzerne Porsche, Piëch, Volkswagen heben derlei Gesten die Bedeutung der Veranstaltung noch extra.
Produkt und Unternehmen sollen bei dem Stuttgarter Sportwagenbauer immer deckungsgleich sein. Soll heißen: Die Autos sind so schnell wie die Firma. Und das war über 15 Jahre lang der Fall: Umsätze und Gewinne explodierten immer weiter, die Mitarbeiterzahl hat sich mehr als verdoppelt und am Ende fuhren auch oft die Autos voran. Als der erste Taycan vor gut vier Jahren auf den Markt kam, da galt das der Fachwelt als Zeichen, dass auch ein Traditionshersteller Tesla Paroli bieten kann und dass sich gleichzeitig das Petrolhead-Auto schlechthin, nämlich Porsche, in die Elektroära überführen lässt.
Vor anderthalb Jahren schickte dann die Konzernmutter Volkswagen Porsche an die Börse. Das sollte der Höhepunkt der bisherigen Wachstumsgeschichte sein. Und Auftakt zu einer umso glänzenderen Zukünftigen. Vorstandschef Oliver Blume, der in einer merkwürdigen Personalunion gleichzeitig der Mutter Volkswagen vorstand und -steht, sprach damals von einem Meilenstein. „Heute geht für uns selbst ein großer Traum in Erfüllung“, sagte er. „Mit Abschluss des Börsengangs schlagen wir ein neues Kapitel in der einzigartigen Geschichte unseres Unternehmens auf.“ Porsche, so die Idee, sollte Ferrari nacheifern, als Luxushersteller bewertet werden und so der Misere der deutschen Autoindustrie entkommen. Traumwagen, Traumaktie, Traumrendite.
Porsche entfernt sich vom Ferrari-Niveau
Heute kann man sagen, dass sich die Hoffnung nicht ganz erfüllt hat. Die Aktie dümpelt seit Monaten um den Ausgabekurs herum, nachdem sie anfangs durchaus zum Höhenflug angesetzt hat. Und die Prognose für die Geschäftszahlen die Blume und sein Vize Lutz Meschke am Dienstag, am Tag nach der Taycan-GT-Premiere vorstellten, ist geeignet, weitere Zweifel zu wecken. Als das Führungsduo die Lage beschrieb, prasselten nur so die Vokabeln auf ihr Publikum ein, die die Managersprache gefunden hat, um schwierige Situationen nicht völlig trostlos aussehen zu lassen: „Sehr herausfordernd“. „Volatil“. „Komplex“. „Anspruchsvoll“. „Angespannt“. „Gesamtschwäche.“ „Gegenwind.“
Das Jahr 2023 hat Porsche trotz auch schon heftiger Geschäftsprobleme hier und dort noch mit einer einigermaßen vorzeigbaren operativen Rendite von 18 Prozent abgeschlossen. Das war zwar genau das Niveau des IPO-Jahrs, aber das allein ließe das Versprechen, dass sich der Hersteller langsam auf Ferrari-Niveau (24 Prozent) zubewegt und mittelfristig wenigstens 20 Prozent erreicht, noch aufrechterhalten. Dann aber folgte die Vorhersage für das laufende Jahr. Sie wirkt wie ein schwerer Dämpfer: 15 bis 17 Prozent bei womöglich gleichbleibendem Umsatz können einen veritablen Gewinneinbruch bedeuten – den ersten seit 16 Jahren.
Zur Schwäche der Aktie sagte Unternehmensvize Meschke überdies lapidar: „Der Weg zum Erfolg am Kapitalmarkt ist nicht immer geradlinig“. Und Blume sagte, er richte die Firma „nicht an kurzfristigen Effekten am Kapitalmarkt aus“. Auch Luxuskonzerne wie LVMH oder Hermès – ausdrücklich die Messlatten von Porsche – erlebten 2023 einen Dämpfer an der Börse. Es ging nur dann schnell zurück nach oben. Man könnte auch sagen: Wenn selbst Porsche mit seiner blitzsauberen Erfolgsgeschichte Grund für Vorbehalte liefert, dann belegt das, wie groß die Skepsis von Investoren gegenüber der deutschen Autoindustrie insgesamt ist. Teure Autos gleich Luxus, der Faktor, den nicht nur Porsche, sondern längst auch Mercedes gerne genutzt hätte, der zieht bislang nicht.
Drei große Probleme
Bei Porsche ballen sich zurzeit die Probleme. Die Chefs sprechen von 2024 als Ausnahmejahr, daher die vergleichsweise maue Prognose. Das impliziert auch das Versprechen, dass das Unternehmen danach dem 20-Prozent-Versprechen wieder näherkommt. Manche der Probleme sind hausgemacht, manche vom Mutterkonzern geerbt, manche kommen von außen. Das erste: viele neue Autos. Das zweite ein altes Auto, das nicht weiterverkauft werden kann. Das dritte: jäher Abfall der Nachfrage in China. Über all dem schwebt die generell eher schwache Konjunktur auf dem Heimatkontinent und die grundsätzlich verhaltene Nachfrage bei den neuen E-Modellen – Phänomene, denen sich auch Porsche nicht ganz entziehen kann.
Das erste Problem: Neue Autos sind eigentlich gut für einen Autobauer, weil sich neue Autos oft besser verkaufen als angejahrte und die Neuerscheinung Begehrlichkeiten weckt. Aber zu viele neue Modelle gleichzeitig bringen eben auch eine Unwucht in die Bilanz, die Finanzmarktakteure nicht mögen. Und sie erhöhen das Risiko, dass etwas falsch läuft. Die Kosten steigen, die Absätze sinken: Teurer wird es, weil Fabriken umgerüstet werden müssen und Vertriebs- und Vermarktungskosten für die neuen Autos steigen. Gleichzeitig stehen am Anfang noch nicht die maximalen Stückzahlen für den Verkauf zur Verfügung. Beide Phänomene, Kosten und Qualitätsrisiken stellen sich bei Porsche nun ein. Schon beim ersten Modell des Neuerscheinungsreigens dem Hybridmodell des SUV Cayenne gab es Softwareprobleme, der Vertrieb musste vorübergehend gestoppt werden. „So viele Anläufe in so kurzer Zeit sind eine enorm komplexe Aufgabe für unser Team“, sagte Blume.
Die wichtigste Premiere danach ist das kleinere SUV Macan, das einige Wochen nach seinem technisch ähnlichen Schwestermodell Audi Q6 E-Tron im Herbst zu den Kunden gehen soll. Die Macan-Baureihe ist neben dem Cayenne der Bestseller von Porsche und sollte eigentlich schon seit über zwei Jahren auf dem Markt sein. Doch hier ist es die Misere von Volkswagens zentraler Softwareeinheit Cariad, die das neue Modell so verzögert hat. Als es geplant wurde, haben sie bei Porsche eine mutige Entscheidung getroffen: Das Brot-und-Butter-Auto, bislang ein klassischer Verbrenner, gibt es künftig nur noch elektrisch. Doch in der langen Wartezeit wuchsen intern die Zweifel, ob diese Entscheidung nicht zu mutig war. Zumal – Glück im Unglück – der „alte“ Verbrenner-Macan sich bis heute weiter glänzend verkauft, in seinem 11. Produktionsjahr. Nur leider hat es der Hersteller versäumt, das Auto rechtzeitig anzupassen, damit es einer neuen EU-Cybersicherheitsrichtlinie genügt, deswegen muss es trotz stabiler Nachfrage im Sommer in Europa aus dem Programm genommen werden.
Lässt sich die Kundschaft wirklich überzeugen auf ein vollelektrisches Auto umzusteigen, gerade wo derzeit die Stimmung in Sachen E-Autos teilweise verhalten ist? Daran gibt es auch intern Zweifel. Zwar hat sich der elektrische Taycan ordentlich verkauft. Aber erstens ist der in der Regel kein Erst-Auto, der Macan schon. Und zweitens zeigen die Taycans auf dem Gebrauchtwagenmarkt enorme Wertverluste. Ist ein elektrischer Porsche nicht mehr die Wertanlage wie der größte Teil der Verbrenner-Porsches? Blume beschwört natürlich die Qualitäten seines neuen Autos. Aber der Macan muss den Markttest erst bestehen.
Einbruch in China
Das größte Problem derzeit ist der schwache Markt in China. Nach Firmenangaben hat Porsche dort im vergangenen Jahr 15 Prozent seines Absatzes verloren. Und die Probleme haben so richtig erst im zweiten Halbjahr begonnen. Intern heißt es, dass der Absatz zeitweise um 30 Prozent nach unten geht und der Trend immer noch anhält. Das wirkt umso schwerer, als Porsche in China stets besonders hohe Gewinne geschrieben hat. Zwar konnte der Hersteller die Delle im vergangenen Jahr ausgleichen, indem er in anderen Märkten besonders gut verkauft hat, etwa in Südkorea oder Malaysia. Aber wenn die China-Schwäche länger anhält, dürften die Auswirkungen noch gravierender werden. Derzeit sagen Blume und Meschke, die Schwäche sei hauptsächlich konjunkturell bedingt und man erwarte zu Jahresende eine Besserung. Anstatt Rabatte zu geben wie die Konkurrenz, verkaufe Porsche einfach weniger Autos, die aber profitabel. Allerdings macht sich der deutsche Hersteller durchaus Sorgen, dass das demonstrative Zeigen von Reichtum in China auf längere Sicht einen schlechten Ruf bekommen könnte. Außerdem ist intern zu hören, dass auch das Händlernetz in dem Markt einer Überarbeitung bedürfe.
Wie sehr sich der Wind dreht, merken auch die Beschäftigten. Am Stammsitz in Zuffenhausen lässt Porsche erstmals seit langem hunderte befristete Verträge auslaufen. Man wolle beschäftigungsseitig flexibler werden, teilte dazu unlängst Personalchef Andreas Haffner mit. Das ist durchaus ein Einschnitt. In den vergangenen Jahren konnten sich befristete Mitarbeiter praktisch sicher sein, später in die Stammbelegschaft übernommen zu werden.
Das Jahr ist jetzt erst einmal schwierig, ja, sagt Porsche Vize Meschke. „Aber wir haben die Grundlage gelegt für das Wieder-Durchstarten 2025.“ Sie soll, sie muss weitergehen, die Porsche-Traumstory. Der Taycan GT an der Teststrecke muss jetzt erst einmal an die Ladesäule.