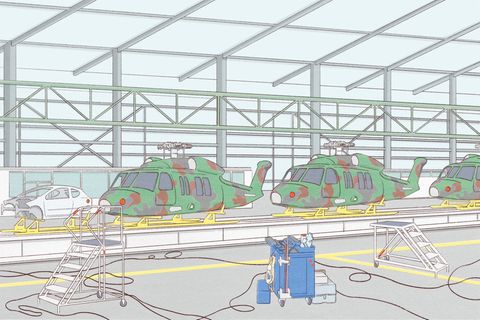Hamsterkäufe und leere Supermarktregale kennen wir zum Glück nur aus den Nachrichten. Doch auch hierzulande kann es im Krisenfall dazu kommen, dass Nahrung und andere überlebensnotwendige Produkte knapp werden. Dafür muss gar nicht Krieg ausbrechen. Bereits Naturkatastrophen (zum Beispiel Hochwasser), Tierseuchen oder Unglücksfälle wie ein Leck in einem Kernreaktor können zu Versorgungsengpässen führen. Davor warnt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Der Staat sorgt auf vielfältige Weise für den Ernstfall vor, damit die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln gewährleistet ist. Aber auch andere wertvolle Stoffe werden gebunkert. Wenige Lagerstätten sind bekannt (und bestens gesichert), andere bleiben streng geheim. Viele Vorräte werden gekauft, andere müssen von den Herstellern bereitgestellt werden. Alles zu den Notfallreserven des Bundes.
Öl, Gold, Erbsen: Diese Notfallreserven bunkert der Bund
Sogar Notfallreserven bekommen im Beamtendeutsch einen wohlklingenden Namen. Die Bundesreserve Getreide soll im Krisenfall dafür sorgen, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Mehl und Brot aufrechterhalten wird. Die Bundesreserve besteht aus Weizen, Roggen und Hafer. Die einzelnen Lager befinden sich aus logistischen Gründen in der Nähe von Mühlen. Der Bestand wird nach etwa zehn Jahren ersetzt oder „gewälzt“.
Die Versorgung mit Trinkwasser ist natürlich besonders detailliert geregelt. Die „Trinkwassernotversorgung nach Wassersicherstellungsgesetz (WasSG)“ soll im Verteidigungsfall greifen. Pro Person und Tag werden laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 15 Liter angesetzt. Außerdem muss Trinkwasser für Krankenhäuser, Nutztiere und überlebenswichtige Betriebe verfügbar sein. Der Bund hat dafür bislang mehr als 5000 Trinkwassernotbrunnen und -quellen geschaffen. Sie sind unabhängig vom Leitungsnetz, liegen meist unmittelbar in Wohngebieten und können sofort in Betrieb genommen werden.
Wenn alle Zahlungssysteme zusammenbrechen, ist nur noch Verlass auf Gold. Hoffentlicht. Deutschland besitzt einen Goldschatz mit einem Gesamtgewicht von rund 3374 Tonnen. Das ist mit Stand Dezember 2017 die zweitgrößte Goldreserve der Welt, wie die Bundesbank mitteilt. Gut die Hälfte der etwa 270.000 Barren (jeder wiegt rund 12,5 Kilogramm) sind in Tresoren der Bundesbank in Deutschland gelagert. Der Rest verteilt sich auf die US-Notenbank Federal Reserve in New York und die Bank of England in London.
Die Abhängigkeit von ausländischem Öl ist ein Schwachpunkt der Versorgungssicherheit in Deutschland. Nach der Ölkrise wurde 1979 der Erdölbevorratungsverband (EBV) gegründet. Die Körperschaft des öffentlichen Rechts hat die gesetzliche Aufgabe, Bestände an Erdöl und Erdölerzeugnissen vorzuhalten. Die sollen den durchschnittlichen Einfuhren für 90 Tage entsprechen. Die Bestände summieren sich auf rund 24 Millionen Tonnen. Sie sind über ganz Deutschland verteilt. Der Clou: Alle Unternehmen, die die betreffenden Produkte im Inland herstellen oder nach Deutschland importieren, müssen Mitglied im Erdölbevorratungsverband sein und seine Finanzierung mit Pflichtbeiträgen sicherstellen.
Neben der Bundesreserve Getreide gibt es noch die Zivile Notfallreserve. In ihr sind gebrauchsfähige Grundnahrungsmittel zusammengefasst: Reis (Lang- und Rundkorn), getrocknete Hülsenfrüchte (Erbsen und Linsen) sowie Kondensmilch. Die Reserve soll im Krisenfall über zentrale Ausgabestellen vor allem in den Ballungsregionen an die Bevölkerung verteilt werden. Ziel ist es, dass jeder Mensch mindestens einmal täglich eine warme Mahlzeit bekommt. Reis und Hülsenfrüchte werden angekauft und gelagert. Aktuell läuft eine Ausschreibung für beide Nahrungsgruppen. Bei der Kondensmilch hingegen bestehen Verträge mit Milch verarbeitenden Betrieben. Sie verpflichten sich, die vereinbarten Mengen ständig für den Bund vorzuhalten.
2009 grassierte die H1N1-Pandemie. Das Bundesgesundheitsministerium legte damals eine „Bundesreserve antiviraler Arzneimittel“ an. Sie bestand aus 7,5 Millionen Therapieeinheiten des Oseltamivir-Wirkstoffpulvers, besser bekannt unter dem Markennamen Tamiflu. Das teilte die Bundesregierung 2013 auf eine Kleine Anfrage der Links-Fraktion mit. Der Vorrat an Grippemittel wurde von Experten „zur Therapie des medizinischen Personals, Personals zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der erkrankten Personen mit erhöhtem Risiko für Komplikationen empfohlen“, hieß es damals. Der Bedarf an diesen Arzneimitteln könne im Falle einer schweren Grippeepidemie „nicht mit den üblichen Vorräten und Produktionskapazitäten gedeckt“ werden.
Kondensmilch? Linsen? Der Speiseplan im Ernstfall klingt vielleicht nicht besonders lecker. Die Produkte wurden aber nicht wegen ihres Geschmacks ausgesucht. Entscheidend sind Nährwert und Lagerfähigkeit. Andere Lebensmittel müssten vor der angestrebten Dauer von zehn Jahren ausgetauscht werden, informiert das Bundesernährungsministerium auf der Seite „Ernaehrungsvorsorge.de“. Allerdings sind die aktuellen Notfallreserven vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. „Derzeit wird geprüft, wie das Konzept der staatlichen Notbevorratung weiter verbessert werden kann“, heißt es vom Ministerium.
Deutschland hat bislang noch nie auf seine Lebensmittelnotvorräte zurückgreifen müssen. Auch bei der Hochwasserkatastrophe 2002 konnte die Versorgung der Bevölkerung auf anderen Wegen sichergestellt werden. Allerdings wurden zu Ostern 1999 laut Bundesernährungsministerium einige hundert Tonnen Linsen, Erbsen und Reis in den Kosovo transportiert, um Flüchtlinge zu versorgen. Dies sei aber ein Ausnahmefall gewesen.