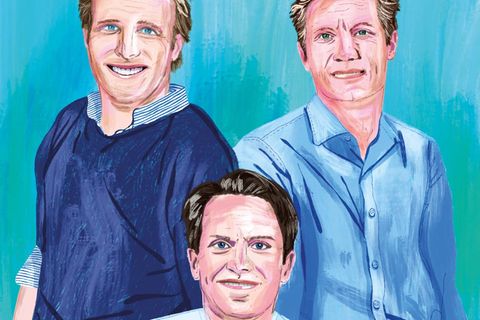Große Wärmeproduzenten und Industrieunternehmen müssen CO2-Zertifikate kaufen, um ihren hohen Ausstoß an Treibhausgasen zu kompensieren. Auch andere Unternehmen, die nicht dazu verpflichtet sind, machen das mittlerweile freiwillig – damit sie sich und ihre Produkte „klimaneutral“ nennen können. Selbst viele Privatpersonen kompensieren etwa Flugreisen, um so ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen.
Doch Skandale um Greenwashing und Bäume, die trotz Versprechen letztlich nie gepflanzt wurden, haben das Vertrauen in die Branche in den vergangenen Jahren stark erschüttert – wie stark, das bekommt gerade das Start-up Recarb zu spüren. Die Gründer wollen mit sogenannten „Carbon Shares“ eine neue Anlageform zur Klimafinanzierung schaffen und hatten schon alles für einen Börsenstart ihres Finanzprodukts vorbereitet. Doch im vergangenen Jahr mussten sie ihr Geschäftsmodell kurzfristig umstellen, weil den Investoren die Transparenz im Markt und vernünftige Prüfverfahren fehlen.
Ende 2023 schrieb das Beratungsunternehmen McKinsey, die Carbon-Dioxide-Removal-Industry könnte bis 2050 mehr als eine Bio. Dollar wert sein. Doch gerade steht sie noch ganz am Anfang mit einem Volumen von wenigen Milliarden Dollar. Recarb ist investorenfinanziert und konnte in seiner ersten Finanzierungsrunde 2,3 Mio. Euro einsammeln. Jetzt steht die zweite Runde an, diesmal soll es mehr werden.
Carbon Shares statt Carbon Credits – CO2-Aktien statt Zertifikate
Die Idee des Start-ups ist, dass zunächst Unternehmen und später vielleicht auch Privatpersonen direkt in die Natur investieren können – und das über die Kapitalmärkte in Form von Carbon Shares. Dann würden Anleger CO2-Aktien kaufen statt CO2-Zertifikate. Über diese Shares sollen Investoren ein Nutzungsrecht an einer CO2-Speicherleistung erwerben, die durch Aufforstungsprojekte erbracht wird. Die klassischen Carbon Credits beziehungsweise CO2-Zertifikate will Recarb nicht ersetzen.
„Im Moment dienen über 90 Prozent der Klimaschutzprojekte der Reduktion oder Vermeidung von Treibhausgasen“, sagt Co-Gründer Daniel Vetterkind im Gespräch mit Capital. „Aber was bei diesen Projekten tatsächlich eingespart wird, ist nicht messbar. Bei uns muss jedes Projekt eine zusätzliche Leistung für das Klima erbringen.“ Die Währung der Zukunft werde sein, wie viel CO2 man aus der Atmosphäre hole. „Und zwar, bei gleichzeitig nachhaltiger Wiederherstellung unserer natürlichen Ökosysteme.“
Recarb hat derzeit acht Projekte in Südamerika, von denen ihnen eine Waldfläche selbst gehört. Anreiz für das Investment soll nicht nur die Speicherung von CO2 sein, sondern im besten Fall sogar ein Gewinn: Wächst nämlich der Wald und speichert so mehr CO2, steigt ähnlich wie bei einer Aktie der Wert des Anteils. Dann sollen Investoren eine Dividende in Form von CO2-Zertifikaten erhalten, die sie selbst nutzen oder weiterverkaufen können. Umgekehrt sinkt natürlich der Anteilswert, wenn der Wald krank wird oder zerstört.
Als nicht reguliertes Finanzprodukt sind die Carbon Shares fertig entwickelt und erste Kunden haben sie bereits direkt bei Recarb gekauft, sagt Vetterkind. Darunter ein Schweizer Technologieunternehmen und ein Transporteur von Pharmaprodukten. Bald sollen ein Immobilienentwickler und ein Kaffeehersteller dazukommen.
Auch für das regulierte Börsenprodukt sei die Strategie vorbereitet gewesen, berichtet Vetterkind. Aber den Börsengang mussten sie im vergangenen Jahr vorerst stoppen. Von der Mindestmarktkapitalisierung waren sie zu weit entfernt und zu wenige Investoren ließen sich überzeugen.
Naturinvestments bedeuten Reputationsrisiko
„Wir sehen eine große Verunsicherung im Markt“, sagt Vetterkind, der Recarb 2022 zusammen mit dem Klimaaktivisten Anton Güthe gegründet hat. In Gesprächen mit großen Börsen und Banken hätten sie festgestellt, dass dem Markt für ein naturbasiertes Finanzprodukt eine wichtige Voraussetzung fehlt: ein valides Prüfverfahren.
„Kein Unternehmen und keine Bank kann die Risiken eines Naturinvestments vernünftig beurteilen. Dafür kann man nämlich keine Bilanzen lesen wie bei einem Unternehmen, sondern braucht Detailwissen über Biologie, Forstwirtschaft und die komplexen Zusammenhänge unserer Ökosysteme in unterschiedlichen Regionen der Erde“, so Vetterkind. Win Projekt aufrechtzuerhalten und Risikomanagement zu betreiben können Banken nicht ohne weiteres.
Ein entsprechendes Due-Diligence-Prüfverfahren hatte Recarb von Anfang mit aufgesetzt – nun wird es zum Haupt-Geschäftsmodell, die Aktien rücken erst einmal in den Hintergrund. Das Start-up bewertet in dem Prüfverfahren die Qualität eines Projekts anhand von 200 verschiedenen Kriterien und ermittelt beispielsweise, wie wahrscheinlich es ist, dass eine bestimmte Menge CO2 eingespart wird. Dazu arbeiten bei Recarb unter anderem Biologen und Forstwissenschaftler, die Daten werden mithilfe von Drohnen und Satelliten erhoben.
Jan Pieter Krahnen, emeritierter Gründungsdirektor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung an der Frankfurter Goethe-Universität, stufte den Beitrag von „Green Finance“ in der Vergangenheit als eher beschränkt ein. Die Hauptarbeit für einen klimafreundlichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft ist aus seiner Sicht hauptsächlich von der Politik zu leisten. Es bedürfe einer Übereinkunft auf wissenschaftlicher Seite, „wie einzelne Elemente der ökologischen Kosten unseres Wirtschaftens und Lebens gemessen werden können“, sagt er zu Capital, die sich dann in Form von Gesetzen und Regulierung niederschlagen müsse. „Hierfür, also für die Beratung der Politik bezüglich einer Rahmensetzung, könnte Recarb eventuell einen Beitrag leisten.“
Das Start-up will nun eine so große Datenbasis aufbauen, dass es mithilfe von KI Projekte von Kunden mit seiner Datenbank abgleichen und bewerten kann. Denn ein Investment in die Natur birgt viele Risiken vom Waldbrand bis zu Baumkrankheiten. Dazu sehen viele Unternehmen in Naturinvestments momentan das große Risiko, die eigene Reputation zu schädigen.
„Einer unserer Kunden hat klar gesagt, dass er den Vertrag mit uns vor drei oder vier Jahren ohne eine detaillierte Due Diligence unterschrieben hätte“, erzählt Vetterkind. „Aber jetzt hat er unser Modell acht Monate lang komplett durchleuchtet, bevor er investiert hat.“ Für ihn ist daher klar: Ohne das Prüfverfahren hätten sie kaum eine Chance das Vertrauen der Anleger zu gewinnen, Greenwashing-Skandale der vergangenen Jahre haben den Ruf der Branche zu sehr ruiniert.
Trotzdem will Recarb dieses Jahr noch acht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Das Selbstbewusstsein jedenfalls ist nicht zu klein, denn die Gründer hoffen, in nicht allzu ferner Zukunft sogar eine große Bank wie JP Morgan überzeugen und mit ihr zusammenarbeiten zu können.