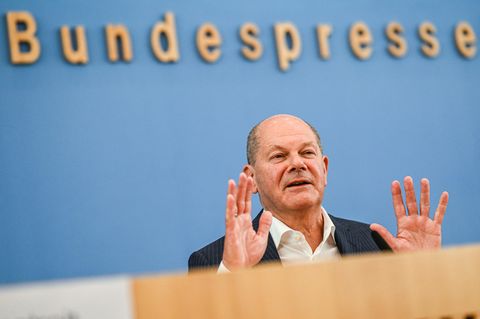Joe Bidens Besuch am heutigen Freitag in Berlin war ein Abschied, aber noch können wir gar nicht ermessen, von wem und von was wir uns alles in den nächsten Wochen verabschieden müssen: von einem US-Präsidenten, der Deutschland und Europa sehr wohlgesonnen war, vom letzten Transatlantiker, wie man so sagt? Oder viel mehr noch von einem Verbündeten, von einer Ordnungsmacht und von einer Weltordnung, die viele Jahrzehnte Bestand hatte und mit der zumindest Europa lange gut gefahren ist?
Dreieinhalb Wochen sind es bis zur Wahl in den USA, aber je näher die Wahl rückt, desto unklarer werden die Verhältnisse. Nachdem es lange so aussah, als falle dem personifizierten Horror vacui der Europäer, Donald Trump, die Präsidentschaft quasi in den Schoß, hat der Wechsel zu Kamala Harris bei den Demokraten die Entscheidung noch mal spannend gemacht. Harris hat aufgeholt, doch die Wahl wird viel enger, als es sich viele hierzulande wünschen würden.
Zwar führt sie in den landesweiten Umfragen mit etwas mehr als zwei Prozentpunkten, doch in vielen der wahlentscheidenden Bundesstaaten ist alles offen: In Arizona etwa liegt Trump vorne, ebenso in Georgia – zwei Staaten, die bei der letzten Wahl knapp Biden holte. Auch in Pennsylvania, einst ein sicherer Staat für die Demokraten, ist der Vorsprung für Harris nur hauchdünn. Am Ende werden es wieder mal wenige Tausend Stimmen in einigen Bundesstaaten sein, die darüber entscheiden, wer ins Weiße Haus einzieht.
Oft wurde die Wahl in den USA bereits als Schicksalswahl beschrieben. Mindestens, so heißt es häufig, entschieden die US-Amerikaner am 5. November über Frieden und Freiheit in ihrem eigenen Land. Gerne holen Kommentatoren hierzulande aber noch etwas weiter aus und stilisieren die Wahl zur Entscheidung über Frieden und Freiheit in der westlichen Welt und Wertegemeinschaft.
Was droht Europa unter Trump?
Das ist auch gar nicht falsch, aber so wird die US-Wahl auch zu einer Projektion für all das, was uns in Deutschland und Europa fehlt oder als ungewiss gilt: Dass Frieden und Freiheit in Europa oder das Schicksal der Ukraine überhaupt von einigen wenigen Tausend Wählern in Arizona, Pennsylvania oder Georgia abhängen kann, führt uns unsere eigenen Schwächen vor Augen – und die unterschwellige Angst, nach fast 80 Jahren unter dem Schutzschirm der USA könnte Europa demnächst abgehängt und verstoßen werden.
Während man Harris stets große Kontinuität mit Biden unterstellt, vermag niemand heute zu sagen, was ein US-Präsident Donald Trump diesmal anstellen würde oder könnte, wenn er noch mal ins Amt kommen sollte. Auch der genaue Wahlausgang in den beiden Parlamentskammern spielt hierfür eine Rolle. Allerdings muss man davon ausgehen, dass Trump diesmal ziemlich schnell einen Plan für seine Regierungszeit vorlegen wird. Anders als 2016 stolpert er nun nicht unverhofft ins mächtigste Amt der Welt, sondern hat im Hintergrund ein Heer an Beratern und Großspendern, die genau wissen, was sie von vier Jahren Trump erwarten.
So oder so stehen die USA in den kommenden Wochen vor einer Zerreißprobe, die wir uns mit unserer stets besorgten und um Ausgleich bemühten Konsenskultur gar nicht vorstellen können. Das gilt vor allem in der Innen-, Justiz- und Gesellschaftspolitik, beim Recht auf Abtreibung etwa oder dem Umgang mit illegalen Einwanderern.
Wirtschafts- und finanzpolitisch jedoch muss der Unterschied zwischen Trump und Harris gar nicht so groß ausfallen: Beide versprechen Änderungen im Steuersystem (wenn auch mit deutlich unterschiedlichen Akzenten), beide sind für weitere gezielte industriepolitische Subventionen (mit ebenfalls unterschiedlichen Schwerpunkten), beide stehen für „America first“ und höhere Zölle auf importierte Waren, insbesondere aus China – und beide stehen für hohe Defizite und deutlich mehr Schulden. Das Commitee for a Responsible federal Budget (CRFB) hat überschlagen, dass Trumps Wirtschafts- und Steuerpläne über die nächsten zehn Jahre weitere 7,5 Billionen US-Dollar an Haushaltsdefiziten bedeuten – bei einer aktuellen Verschuldungsquote der USA in Relation zur Wirtschaftskraft von 123 Prozent. Im Vergleich dazu wirken Harris’ Pläne, die etwa halb so groß ausfallen, geradezu günstig.
Nervosität an den Märkten
Neben allen absehbaren außen- und handelspolitischen Konflikten ist es dieser wachsende Berg an US-Schulden, der die Weltwirtschaft in den kommenden vier Jahren in Atem halten wird. Denn obwohl die US-Wirtschaft im Prinzip robust wächst, verprassen die USA weiter Geld, das sie nicht haben, für alles Mögliche und testen damit ihre eigene Kreditwürdigkeit und das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte. Passend dazu veröffentlichte der Internationale Währungsfonds in dieser Woche eine eindringliche Warnung: Die öffentlichen Schulden erreichten Ende dieses Jahres erstmals den Wert von 100 Billionen US-Dollar, das sind 115 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung.
Nun kann man lange streiten, ob sich die USA ein dauerhaft so hohes Defizit leisten können – immerhin haben sie mit dem Dollar und der Notenbank Fed auch zwei sehr mächtige Institutionen in ihrem Lager. Doch die Märkte fackeln nicht lange mit einer Antwort: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt seit einiger Zeit schon über der Schwelle von 4 Prozent, daran hat auch die jüngste Leitzinssenkung der Fed nichts geändert, im Gegenteil. Und wenn vielleicht nicht die Schulden selbst, so beunruhigt die Investoren doch zumindest die Aussicht auf eine weiterhin erhöhte oder sogar bald wieder steigende Inflation in den USA. Gründe für einen neuen Teuerungsschub gäbe es einige – höhere Importzölle ebenso wie auf Pump finanzierte Ausgabenprogramme oder Steuersenkungen.
Die Reaktion der Märkte ist eindeutig: Egal ob Harris oder Trump, die Nervosität nimmt auch hier zu – und zwar sogar unabhängig vom Wahlausgang.