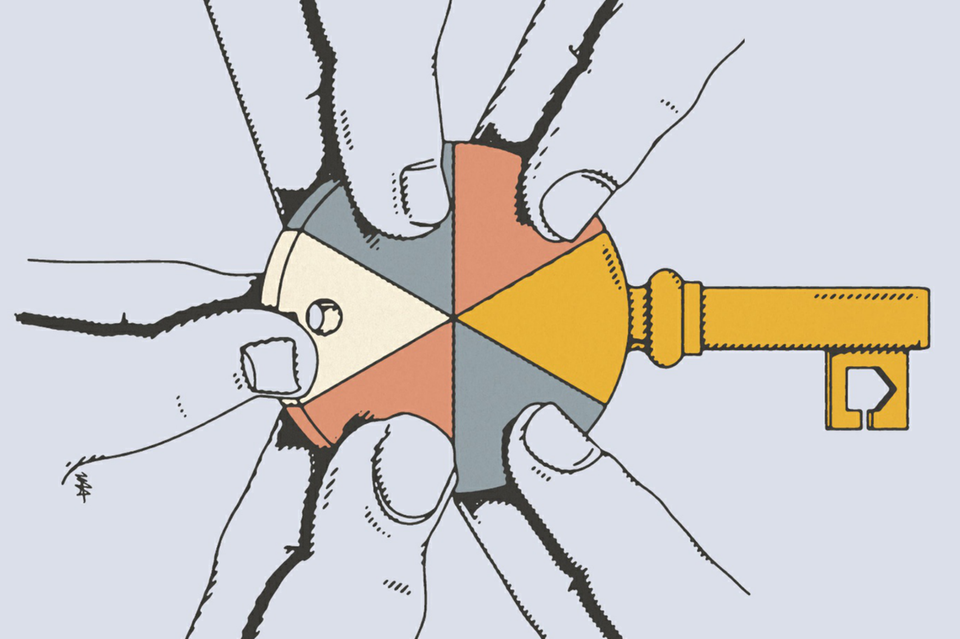Es ist ein fast schon apokalyptisches Szenario für die deutsche Wirtschaft, das die Beamten des Bundesinnenministeriums in einer internen Analyse zeichnen. Falls es nicht gelinge, die Coronapandemie zu kontrollieren und einzudämmen, schreiben sie in einem internen Strategiepapier, könnte die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 32 Prozent einbrechen, die Wertschöpfung der Industrie gar um 47 Prozent. „Dieses Szenario kommt einem wirtschaftlichen Zusammenbruch gleich, dessen gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen kaum vorstellbar sind“, heißt es in dem Papier von Mitte März, das Capital vorliegt. Bezeichnung dieses Worst-Case-Szenarios: „Abgrund“.
Die vertrauliche Analyse mit dem Titel „Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bringen“, die Innenminister Horst Seehofer in Auftrag gab, stammt aus der Grundsatzabteilung seines Hauses. Sie entstand mithilfe externer Experten, etwa des Robert-Koch-Instituts, aber auch der Wirtschaftsforschungsinstitute IW Köln und RWI. In dem Strategiepapier beschäftigen sich die Experten nicht nur mit der Frage, mit welchen Mitteln sich die Zahl der Corona-Infizierten und Toten begrenzen lässt – sondern auch mit den Auswirkungen der jeweiligen Krisenstrategien auf die Volkswirtschaft.
Im mildesten Szenario (Bezeichnung: „Schnelle Kontrolle“) gehen Seehofers Berater davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um vier Prozent schrumpft, die Wertschöpfung der Industrie um neun Prozent. In diesem Fall könne Deutschland dank starker Nachholeffekte ab Sommer mit einer wirtschaftlichen Bilanz aus der Krise kommen, die der Rezession in der Weltwirtschaftskrise 2009 ähnele. Der „wirtschaftliche Best Case“, heißt es in der Analyse, gelte für den Fall, dass die Zahlen der Neuinfizierten durch den Shutdown bis zum Ende der Osterferien „deutlich heruntergehen“.
Massentests nach dem Vorbild Südkoreas
In diesem – auch bei den gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung bestmöglichen – Szenario könnten Schulen und Kitas ab dem 20. April wieder geöffnet werden. Nach einer Übergangszeit von drei Monaten, in denen die Unternehmen noch unter den Folgen der Grenzschließungen und unterbrochener Lieferketten leiden, werde sich die Lage dann auch in der Wirtschaft wieder normalisieren, schreiben die Experten. Die Voraussetzung dafür: Für die Zeit nach der Aufhebung des Shutdowns müssten massiv erhöhte Testkapazitäten zur Verfügung stehen. Auf diese Weise müsse sichergestellt sein, dass Personen, die sich neu mit dem Virus anstecken, sofort identifiziert und isoliert werden können – nach dem Vorbild Südkoreas, das mithilfe von Massentests die Ausbreitung der Epidemie gestoppt hat.
Zu pessimistischeren Prognosen gelangen die hochrangigen Experten dagegen für den Fall, dass es nicht gelingt, die Verbreitung der Infektionen zügig und auf Dauer einzudämmen. In einem weiteren Szenario („Rückkehr der Krise“) gehen Seehofers Berater von der Annahme aus, dass nach einem zweimonatigen Shutdown ein weitgehend normales Wirtschaftsleben wieder möglich ist – jedoch nur bis zu einer zweiten schweren Epidemiewelle im Herbst. Für die Gesamtwirtschaft erwarten sie in diesem Fall einen Rückgang von 11 Prozent im laufenden Jahr, für die Industrie ein Minus von 19 Prozent. Dieses Szenario sei „deutlich kritischer als die Krise von 2009“, heißt es in dem Arbeitspapier des Ministeriums, aus dem in Teilen zuerst der Rechercheverbund von SZ, NDR und WDR zitiert hatte .
Nur ein wenig glimpflicher käme die Volkswirtschaft demnach davon, wenn die Ausgangsbeschränkungen bis zu den Sommerferien Mitte Juli aufrecht erhalten werden müssten, um der Epidemie Herr zu werden. In diesem Szenario („Langes Leiden“) kalkulieren Seehofers Beamte damit, dass es nach der Beendigung des Shutdowns aufgrund der Krisenerfahrung und der hohen Unsicherheit nur „in geringerem Ausmaß“ zu Nachholeffekten kommt. Im Ergebnis dürfte das Bruttoinlandsprodukt um neun Prozent schrumpfen, die Industrie um 15 Prozent. Dies dürfte allerdings „eher eine optimistische Annahme“ sein, schreiben die Beamten. Vielmehr drohten in einer langen Zeit der Krise sich selbst verstärkende Effekte und eine „systematische Abwärtsspirale“.
„Unvorstellbare wirtschaftliche Katastrophe“
Sollte ein monatelanger Shutdown nötig sein, um die Epidemie unter Kontrolle zu bringen, sehen Seehofers Strategen auch die Gefahr, dass sich die Situation Richtung Worst-Case-Szenario entwickeln könnte. Annahme für das „Abgrund“ betitelte Extremszenario ist eine „unkontrollierte und unkontrollierbare Entwicklung“ mit Ausgangsbeschränkungen bis Ende des Jahres. Bei sich verstärkenden Zweitrundeneffekten und Negativerwartungen sei auch „beschleunigte Abwärtsdynamik nicht auszuschließen“ – mit einem BIP-Einbruch von sogar noch mehr als 32 Prozent. Die Folge: eine „unvorstellbare wirtschaftliche Katastrophe, die gesellschaftlich zu kaum vorstellbaren Konsequenzen führen würde“.
In ihrem Papier machen die Berater aus dem Innenministerium klar, dass sie das Nachdenken und Reden über Worst-Case-Szenarien in der aktuellen Lage für geboten halten. An einer Stelle, an der es um die Gesundheitsrisiken des Virus geht, ist sogar von einer „gewünschten Schockwirkung“ die Rede. Die Beamten empfehlen, dass die Bundesregierung in ihrer Kommunikation den Extremfall mit allen Folgen für die Bevölkerung verdeutlichen solle, um die Bürger dazu zu bringen, die Maßnahmen mitzutragen und ihren Beitrag leisten, etwa durch Social Distancing. „Um die gesellschaftlichen Durchhaltekräfte zu mobilisieren, ist das Verschweigen des Wort Case keine Option“, heißt es in dem Papier.
Auf Anfrage von Capital äußerte sich das Innenministerium nicht zu den Inhalten des Arbeitspapiers – auch nicht zu der Frage, inwiefern Ressortchef Seehofer sich die Prognosen und Empfehlungen seiner Berater zu eigen macht. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, das innerhalb der Bundesregierung die Federführung für Konjunkturprognosen hat, sagte, es sei „vorausschauend“, dass sich die Ressorts „in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich“ auf verschiedene Szenarien einstellen, um auf alles vorbereitet zu sein. Wirtschaftsminister Altmaier werde „in den nächsten Tagen eine erste eigene Einschätzung zur wirtschaftlichen Entwicklung veröffentlichen“.
Seehofers Experten offen für Corona-Bonds
Noch für Konfliktstoff innerhalb der Bundesregierung sorgen könnte eine Passage des Strategiepapiers, in der sich die Berater des Innenministeriums Gedanken über die wirtschaftspolitischen Reaktionen auf die Coronakrise machen – und sich dabei auch offen für die höchst umstrittenen gemeinsamen EU-Anleihen zeigen. Als Antwort auf die aktuelle Krise fordern Seehofers Experten eine „koordinierte fiskalpolitische Strategie auf europäischer Ebene“. „Diese Anstrengungen müssen die finanzielle Unterstützung für andere Länder der EU einschließen, die sonst durch die Eindämmung der Krise finanziell überlastet wären (insb. Italien)“, schreiben sie. Neben den Aktivitäten der Europäischen Zentralbank bedürfe es weiterer Instrumente, etwa bestehende oder frische Kreditlinien des Euro-Rettungsfonds ESM oder „COVID-19-Gemeinschaftsanleihen“.
Seit der Verschärfung der Coronakrise tobt in der EU ein Streit über die Frage, auf welche Weise besonders von der Epidemie betroffene Staaten finanziell entlastet werden könnten. Vehemente Verfechter einer gemeinsamen Schuldenaufnahme sind Frankreich, Italien, Spanien und andere Länder. Deutschland und die Niederlande zählen zu den strikten Gegnern. In den vergangenen Tagen hatten auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wiederholt ihren Widerstand gegen Euro-Bonds bekräftigt und auf bestehende Hilfsinstrument wie den Euro-Rettungsfonds ESM verwiesen.
Dagegen wollen die Beamten von Innenminister Seehofer Corona-Anleihen nicht ausschließen – auch mit Blick auf den festgefahrenen Streit unter den EU-Staats- und Regierungschefs, der eine europäische Antwort auf die Krise erschwert: „Die Diskussion um die konkreten Instrumente sollte nicht den Blick auf die Notwendigkeit einer koordinierten fiskalischen Strategie verstellen“, schreiben sie in ihrem Papier.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden