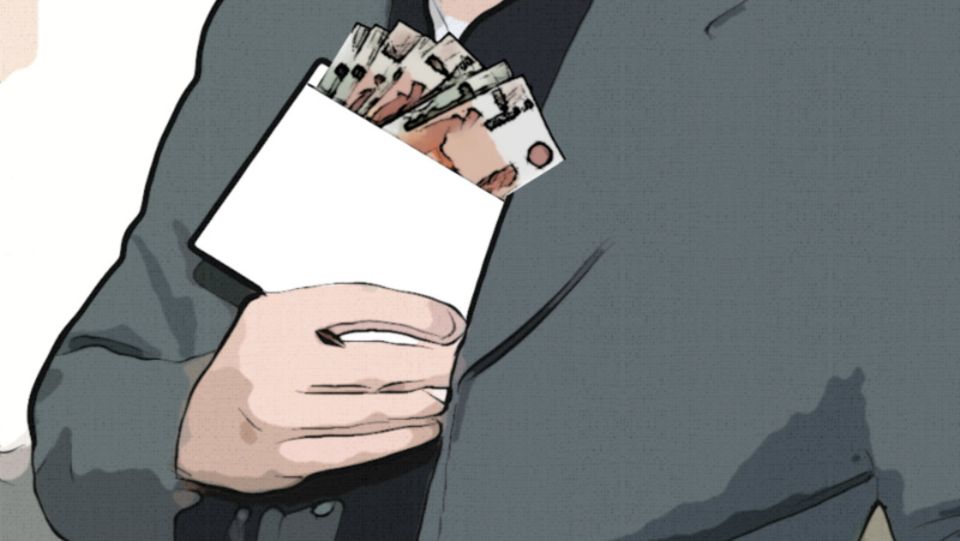Alina Mungiu-Pippidi leitet das Europäische Zentrum für Antikorruption und Staatsaufbau (ERCAS) an der Hertie School of Governance in Berlin. Die Ergebnisse des Anticorrp Projekts, auf die der Artikel Bezug nimmt, sind veröffentlicht in: „Anticorruption Report 1 (Controlling Corruption in Europe)“ und „Anticorruption Report 2 (The Anticorruption Frontline).“ Beide sind im Barbara Budrich Verlag erschienen
Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi war ein 27jähriger tunesischer Straßenverkäufer, der sich am 17. Dezember 2010 selbst anzündete. Er protestierte damit gegen die Konfiszierung seiner Waren, mit denen er illegal Handel getrieben haben soll, wie die staatlichen Behörden behaupteten. Damit war das Feuer der tunesischen Revolution und später des Arabischen Frühlings gelegt und Bouazizi wurde sofort zum Helden – schließlich war der damalige Präsident Zine el-Abidine Ben Ali der typische Fall eines korrupten Führers, dessen Frau sich ohne Genehmigung eine Villa auf dem Gelände des Unesco-Welterbes Karthago gebaut hatte.
Der Held der tunesischen Revolution hatte es – wie die meisten Kleinhändler in armen Ländern – tatsächlich vermieden, Steuern zu bezahlen. Er hielt das für gerechtfertigt, weil der Staat so wenig für ihn und seine Familie getan hatte, während Präsident Ben Ali und seine Frau aus dem Vollen schöpften. Im Gegenzug könnte der Staat natürlich argumentieren, dass es an den notwendigen Ressourcen zur Finanzierung staatlicher Leistungen fehle, da Menschen wie Bouazizi ihre Steuern nicht zahlten. Es könnte sich herausstellen, dass das Geld für Ben Alis Villa und anderes Beutegut nicht ausreichen würde, um allen Bedürftigen Bildung und medizinische Versorgung zu bieten, die keine Steuern zahlen.
Kurz gesagt: In der tunesischen Situation scheint über das Paradigma von Räuber versus Opfer hinaus das zentrale Problem zu sein, dass ein zwischen den Parteien vereinbarter sozialer Vertrag fehlt, um SOWOHL Korruption ALS AUCH Hinterziehung zu vermeiden. Nur ein solcher Vertrag würde Entwicklung eine Chance geben.
Vetternwirtschaft die Regel
Protestbewegungen in den Straßen Neu Delhis, Sofias und Rio de Janeiros haben sich erst kürzlich die Korruption auf die Flaggen geschrieben. Es ist nicht schwer zu verstehen warum. Die meisten der für das Globale Korruptionsbarometer in 107 Ländern 114.000 Befragten glauben, dass Korruption im vergangenen Jahr zugenommen hat. Zwei Drittel betrachten Vetternwirtschaft als die Regel in der öffentlichen Verwaltung (nur ein Viertel hatte im vorgegangenen Jahr selbst zu Bestechung gegriffen). Mehr als 50 Prozent glauben, dass ihre Regierung von Interessengruppen vereinnahmt ist und auf neun Personen, die die nationale Antikorruptionsstrategie als ineffektiv beurteilen, kommt nur eine, die überzeugt ist, dass sie funktioniert.
Der Grund dafür, warum sich Menschen über Korruption beklagen, wird offensichtlich, wenn man sich die Länder anschaut, in denen solche Wahrnehmungen dominieren. Neue Forschungen des Anticorrp EU FP7 Projekts zeigen, dass Korruption mit einer großen Zahl bösartiger Symptome einhergeht, die Entwicklung und Wohlbefinden behindern. Hohe Korruptionswahrnehmungen sind signifikant verknüpft mit geringen öffentlichen Ausgaben für Gesundheit aber hohen Investitionen für Regierungsprojekte – von Brasiliens teurer Weltmeisterschaft bis hin zu Ben Alis grandioser, aber leerer Mega-Moschee. Und sie sind verbunden mit einer schwachen Ausschöpfung von Unterstützungsfonds, einer geringen Steuereintreibung, einem niedrigem Ertrag von öffentlichen Investitionen und der Auswanderung qualifizierten Personals (Brain-Drain).
2013 stimmten nur die Bürgerinnen und Bürger der nordeuropäischen Länder der Aussage zu, dass Karrieren im öffentlichen wie privaten Sektor vorwiegend auf harter Arbeit und Kompetenz beruhten. Der Rest der Europäer sieht hingegen in der Vetternwirtschaft also in persönlichen Beziehungen, das Ticket zum beruflichen Erfolg. Dabei handelt es sich um die hinterlistigste und am weitesten verbreitete Form von Korruption.
Parteien machen "Beute"
Warum lösen Wahlen dieses Problem nicht? Und warum haben junge Demokratien die gleichen Probleme? Das lässt sich empirisch belegen von den niedrigen Steuererlösen bis hin zur Tatsache, dass die wichtigste Quelle für Reichtum Macht und Autorität ist? Warum funktioniert die Korruptionskontrolle in den meisten alten Demokratien (allerdings nicht in allen) und in so wenigen jungen Demokratien (mehr als 89 Länder, die reguläre freie Wahlen abhalten sind systematisch korrupt)?
Wahlen scheinen nicht ausreichend, um die Mächtigen daran zu hindern, öffentliche Ressourcen zu ihrem persönlichen Nutzen einzusetzen. Wahlen können nicht kontinuierlich kontrollieren, dass, wer auch immer gewählt wird, nach dem Gesetz regiert und dass der Staat alle gleich und fair behandelt. In vielen jungen Demokratien sind politische Parteien ‚Beutemaschinen‘ öffentlicher Ressourcen. Historisch betrachtet sind sie ein fortgeschrittenes Vehikel, um Gruppen Vorteile zu verschaffen, nach der Familie, dem Clan oder Stamm-Gruppenstrukturen, die gelernt haben, ziemlich gut neben den modernen Organisationen zu existieren, indem sie ihres unpersönlichen und objektiven Charakters entleeren. Das bekannteste Beispiel ist die Politisierung des öffentlichen Dienstes in korrupten Ländern (einschließlich Krankenhäuser und Schulen, wo Arbeitsplätze als Parteibeute gelten).
Mehr als 160 Länder in der Welt haben die UN Konvention gegen Korruption ratifiziert und versprochen, sich zu modernisieren. Aber wenn man Korruption auf einem systematischen Niveau als einfachen Machtmissbrauch versteht, dann sind Antikorruptionsmaßnahmen notwendigerweise politisches Handeln. Die wenigen Länder, die in den letzten 40 Jahren erfolgreich Korruption in den Griff bekommen haben – Länder wie Uruguay und Estland – haben dies nicht durch Antikorruptions-Agenturen oder andere Wunderwaffen der internationalen Gemeinschaft geschafft. Ihr Erfolg beruht vielmehr darauf, dass es einer kritischen Masse gelang, Machtverhältnisse auszubalancieren und Menschen an die Macht zu wählen, die den alten Teufelskreis unterbrachen und neue Spielregeln einführten.
Für unsere Generation ist es der einzige Weg, die demokratischen Revolutionen, die 1989 begannen, zu vollenden, in dem wir Privilegien und Vetternwirtschaft abschaffen. Integrität ist ein öffentliches Gut. Ihre Konstruktion bedarf kollektiven Handelns und ist deswegen mit den Problemen kollektiven Handelns im Allgemeinen belastet. Derzeit zielen die neuen Wellen globalen Unfriedens auf diese Konstruktion – Unfrieden, der auf die Leistungen nicht-perfekter Demokratien zielt und nicht auf Demokratie an sich.