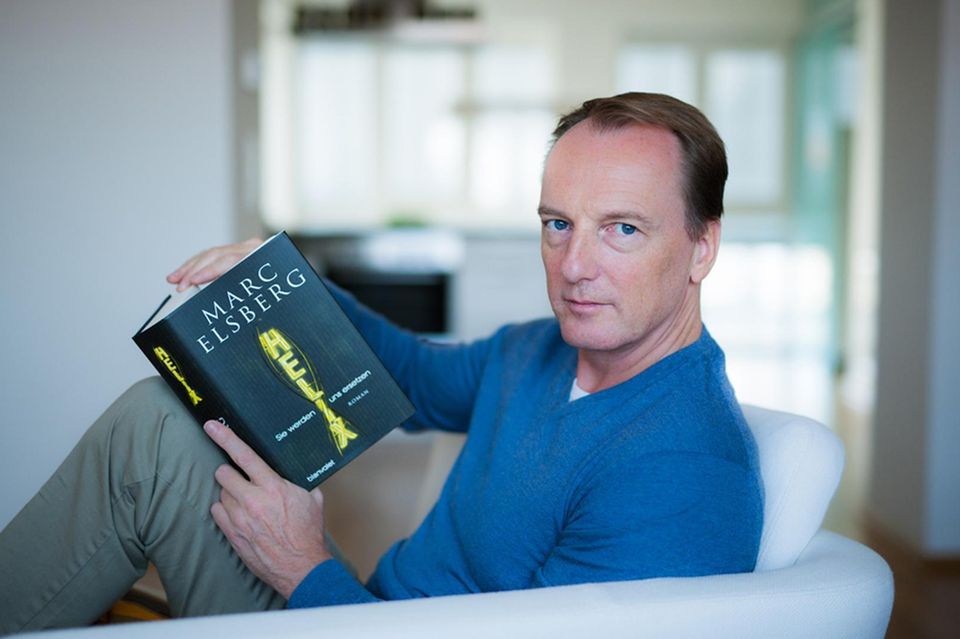Frank Bickenbach, Holger Görg und Wan-Hsin Liu sind Wissenschaftler am Institut für Weltwirtschaft Kiel
Die jüngste Demonstration chinesischer Technologieentwicklung kam besonders groß daher: ein Passagierflugzeug, das der staatliche Hersteller COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) auf einer Luftfahrtmesse vorstellte und das in vier, fünf Jahren den westlichen Anbietern Airbus und Boeing das Fürchten lehren soll. Angesichts der Entwicklung in den vergangenen Jahren erscheint es unvermeidlich, das Chinas Industrie in der Technologieentwicklung zügig aufschließt und in einer zunehmenden Zahl von Branchen zum Konkurrenten etablierter Anbieter von technisch anspruchsvollen Produkten wird. Doch bei genauem Hinsehen zeigt sich, ein Selbstläufer wird dieser Aufholprozess nicht.
Zweifellos hat sich China beeindruckend schnell zu einem Land der Hochtechnologie entwickelt. Flugzeuge, Hochgeschwindigkeitszüge und Smartphones aus China – vor zwanzig Jahren war das noch fast unvorstellbar. Seit der Jahrtausendwende aber hat die Regierung den Kurs immer stärker auf Innovationen und technische Modernisierung ausgerichtet. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben (F&E) sind zuletzt erheblich stärker als in den führenden Industrieländern gestiegen. Sie beliefen sich 2013 schon auf etwas mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und liegen damit auf dem Durchschnittsniveau der europäischen Länder – und das bei einer enormen Wirtschaftsleistung. Firmen wie die IT-Konzerne Huawei und ZTE gehören heute technologisch zu den innovativsten weltweit.
Finanzierungsprobleme für Start-ups
Allerdings: Chinas F&E-Intensität ist immer noch deutlich niedriger als die in traditionell F&E-intensiven Ländern wie Deutschland, Japan, USA, Schweiz oder auch Südkorea. Die Zahl der Patentanmeldungen in China ist zwar hoch, seit 2010 liegt das Land hier weltweit an der Spitze. Doch vielfach wird argumentiert, dass der von der chinesischen Politik stark geförderten Zunahme der Quantität der Erfindungen (beziehungsweise Patente) oft eine geringe Qualität oder Erfindungstiefe gegenübersteht.
Hinzu kommen Finanzierungschwierigkeiten. Kleine und mittlere Unternehmen und vor allem High-Tech Start-ups kommen in China noch schwieriger an Geld als in Industrienationen. Die meist staatlichen Banken bevorzugen große beziehungsweise staatliche Unternehmen, und neben diesen Hauptakteuren im Finanzmarkt gibt es nur einen wenig entwickelten Kapitalmarkt für Investitionen in risikobehaftete Innovationen. Ein weiterer Aspekt ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften. Zwar hat die Hochschulreform die Ausgangslage verbessert und die Zahl der Uniabsolventen nach oben getrieben, aber es gibt noch einen großen Nachholbedarf hinsichtlich der Qualität der Ausbildung und der Qualifikationen der Arbeitnehmer im Vergleich zu traditionellen Innovationsstandorten. Zugleich gelingt der Technologietransfer von Universitäten zu Unternehmen aufgrund mangelnder Kooperation zu selten.
Auch die staatlichen Eingriffe in den Innovationsprozess haben Nebenwirkungen. Es entscheidet oft nicht der Markt, wo die Schwerpunkte oder vielmehr die Richtung der Innovationen liegen. Staatliche geförderte Unternehmen binden große Mengen von Kapital und qualifizierten Beschäftigten, arbeiten in der Regel aber weder effizient noch innovativ. Staatsbetriebe investieren auf Druck der Regierung zwar zunehmend in F&E, doch sie sind häufig wenig erfolgreich darin, Forschungsausgaben in Innovationen und Patente umzusetzen.
Der Trend ist positiv
Und schließlich gibt es das Problem der mangelnden Rechtssicherheit und der weiterhin mangelhaften Durchsetzung des Schutzes geistigen Eigentums. Das behindert insbesondere auch eine Kooperation chinesischer Unternehmen mit innovationsstarken multinationalen Unternehmen, weil diese einen unerwünschten Technologietransfer befürchten müssen.
Wo steht Chinas Wirtschaft also in Sachen Innovation? Zieht man die Patentenstatistiken heran, ist China in den vergangenen Jahren besonders innovativ, wenn es um moderne Werkstoffe und Werkstoffchemie, digitale Kommunikation, sowie die Solar- und Windenergie geht. Die gezielte politische Förderung (einschließlich durchaus großzügiger finanzieller Unterstützung) in diesen Industrien spielt hier eine entscheidende Rolle. Zusätzlich hilft die Integration dieser Unternehmen in globalen Wertschöpfungsketten dabei, von den weltweiten Technologieführern zu lernen, mit ihnen zu kooperieren und Zugang zu internationalen Märkten zu gewinnen.
Das Land ist klar auf einem positiven Trend, was Innovationen und Technologie angeht. Um diesen Trend fortzusetzen oder gar zu beschleunigen, ist es aber wohl erforderlich, die bestehenden institutionellen Probleme anzugehen und Forschung und Entwicklung stärker als bisher an den Marktbedürfnissen auszurichten. Sollte China dies gelingen, dürfte der internationale Markt für Passagierflugzeuge, Smartphones oder andere technologie-intensive Güter noch deutlich wettbewerbsintensiver werden.