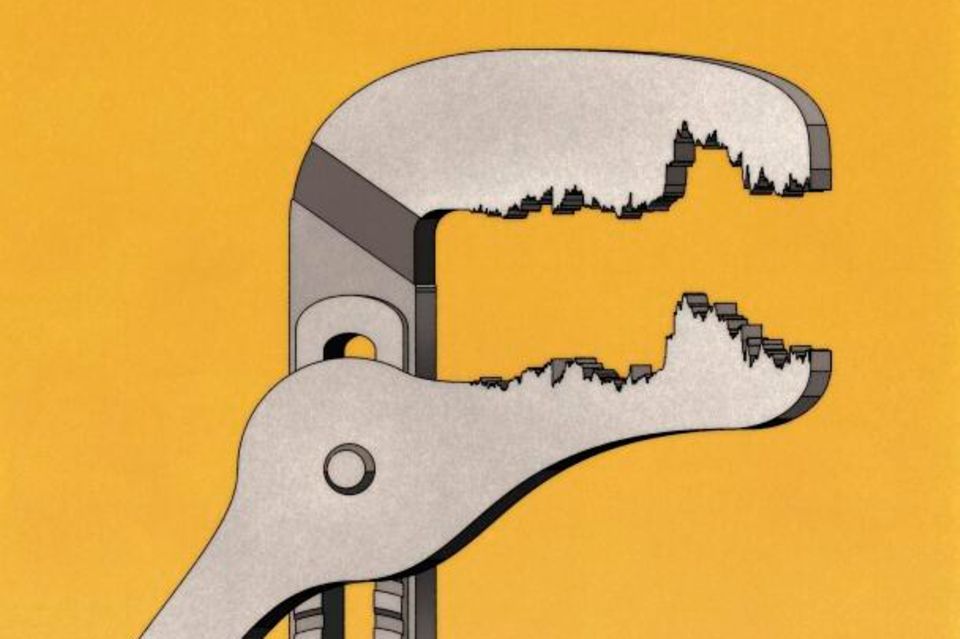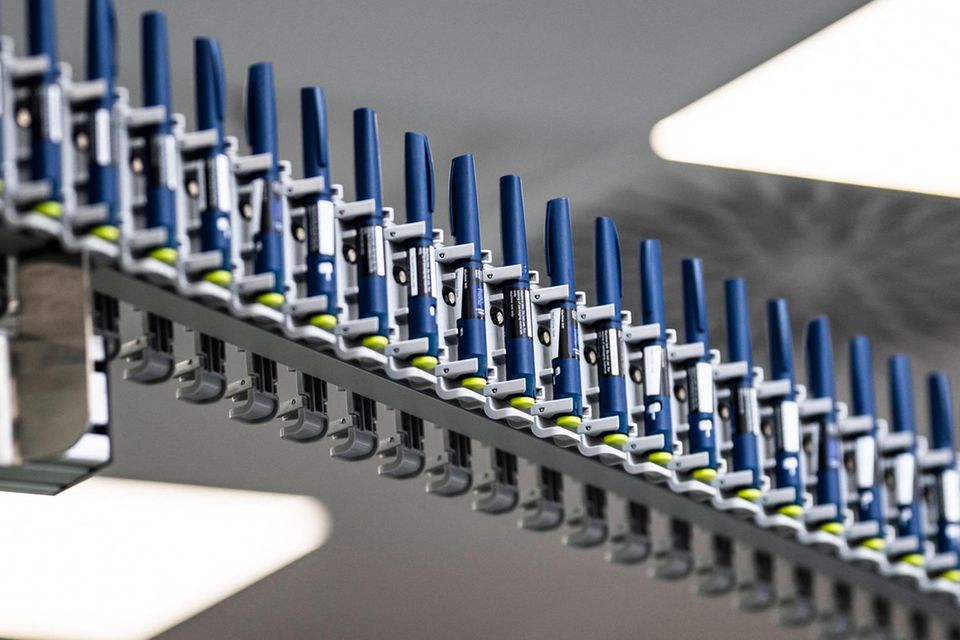Wer vom Wachstum einer Volkswirtschaft profitieren will, investiert normalerweise in die Aktien des Landes. Es wäre also naheliegend, wenn Anlegerinnen und Anleger ihr Geld in den vergangenen Dekaden nach China geschafft hätten – dort, wo es das große Wachstum gab. Stattdessen lief der China-Index CSI 300 aber mehr oder weniger seitwärts zur Inflation. Der wichtige Hang-Seng-Index ist inzwischen sogar auf den Stand von 2005 gesunken.
Zu Wochenbeginn hat es an den Börsen in Schanghai und Hongkong erneut kräftige Verwerfungen gegeben. Die chinesischen Börsen erreichten ein Fünf-Jahres-Tief, Investoren stießen China-Titel in großem Umfang ab. Mit einem Minus von rund sieben Prozent brachen vor allem Immobilienaktien ein. Viele Anlegerinnen und Anleger haderten damit, dass die chinesische Zentralbank auf eine Zinssenkung verzichtet hatte und fürchteten zu wenig Stimulierung für die stotternde Volkswirtschaft von staatlicher Seite. „Das Vertrauen der Anleger in die inländische Wirtschaftspolitik bleibt schwach“, so Vermögensverwalter Minsheng Royal Fund Management mit.
Die Abwärtsdynamik nahm derart Fahrt auf, dass sich die Regierung in einer Kabinettssitzung unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Li Qiang zu einem Rettungspaket genötigt sah: Laut einem Bericht der Agentur Bloomberg will die Regierung als Teil eines Stabilisierungsfonds etwa zwei Billionen Yuan (255 Mrd. Euro) mobilisieren, um Aktien zu kaufen. Dabei sollen Chinas Staatsbetriebe im Ausland liegendes Geld nutzen, um über die Hongkonger Börse chinesische Aktien zu erwerben. Die Aktienmärkte beruhigten sich daraufhin etwas und zogen um rund einen halben Prozentpunkt an.
Analysten: „Dritthöchste Abflüsse aller Zeiten“
Chinas Aktienmärkte sind seit Jahresbeginn auf Talfahrt. Laut den Analysten der Schweizer Bank Julius Bär gibt es dafür vier Gründe: die schwache Konjunktur, ein möglicher neuer Handelskrieg mit den USA, die Dauerkrise am Immobilienmarkt und staatliche Interventionen in die Finanzwerte. Gerade letztere zählten zuletzt zu den Verlieren – und hier vor allem Finanz- und Versicherungswerte. Die China Merchants Bank notiert fast 50 Prozent unter dem Wert von Januar 2022, die China Life Insurance immerhin 25 Prozent darunter. Staatschef Xi Jinping sieht in der Branche die Schuldigen für Geldwäsche, Zockerei und Korruption. Xi kündigte daher eine „Berichtigungskampagne“ an, will der Branche also strengere Regeln vorschreiben.
Vor allem ausländische Investoren scheinen sich immer mehr von China abzuwenden. Eigentlich hatten sie auf einen V-Effekt nach dem Aufheben der Covid-Einschränkungen vor einem Jahr gehofft. Doch die Hoffnungen entpuppten sich als zu optimistisch. Von den 30 Mrd. Dollar, die ausländische Anleger bis August zusätzlich in chinesische Aktien investiert hatten, gingen laut „Handelsblatt“ 90 Prozent schon wieder verloren. „Über das ganze Jahr 2023 haben Auslandsinvestoren Geld aus China abgezogen, im Dezember waren es sogar die dritthöchsten Abflüsse aller Zeiten“, zitiert das Blatt Louis-Vincent Gave vom Analysehaus Gavekal Research.
Laut der US-Bank JP Morgan sind in diesem Jahr bereits Aktien-Positionen im Wert von 1,6 Mrd. Dollar aus China abgezogen worden. Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat sein China-Sentiment von „übergewichtet“ auf „neutral“ abgestuft. Die Gründe dafür seien langfristig zu finden – in der geopolitischen Diskussion um einen möglichen Taiwan-Krieg, strukturellen Herausforderungen und der alternden Bevölkerung.
29. Januar: Tag der Entscheidung für Evergrande
Nicht nur ausländische Investoren sind zunehmend skeptisch, was die Entwicklung in China angeht. Selbst unter Chinesen wächst offenbar das Misstrauen. Chinesische ETFs auf Auslandsmärkte wie Japan und Indien notieren mit einem Bewertungsaufschlag gegenüber ihrem Gesamtvermögen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters musste ein Fonds sogar seine Zeichnungen einschränken. Das ist umso bemerkenswerter, da die chinesische Regierung heimische Aktien stark bewirbt und sie als bessere Alternative zum kriselnden Immobilienmarkt positioniert.
Der ist nämlich ebenfalls stark unter Druck. Am 29. Januar läuft eine wichtige Frist für den hochverschuldeten Baukonzern Evergrande ab, um eine drohende Liquidation abzuwenden. 300 Mrd. US-Dollar Schulden lasten auf dem Konzern, der bereits mehrfach Rückzahlungen nicht fristgerecht leisten konnte.
Evergrande steht exemplarisch für die Krise der chinesischen Immobilienwirtschaft. Jahrelang ging es für die Branche nur nach oben – etwa, weil die Menschen aus beruflichen Gründen vom Land in die Städte zogen, und hierfür Wohnraum brauchten. Um diese Transformation zu leisten, nahmen viele Bauentwickler Kredite auf. Doch mit Einsetzen der Corona-Krise wurde deutlich, dass die Entwickler mitunter zu optimistisch waren. Wohnungen stehen leer, die demographische Entwicklung geht zurück. Dazu kommen hausgemachte Fehler, die zu Projektabbrüchen führten.
Evergrande war von diesen Entwicklungen besonders betroffen und beantragte bereits 2021 ein Insolvenzverfahren. Eigentlich wollte der Konzern schon 2022 einen Restrukturierungsplan vorlegen, was bislang aber immer scheiterte. Der 29. Januar dürfte die letzte Gnadenfrist sein, glauben Experten. Davon geht allerdings eine große Gefahr für die gesamte chinesische Wirtschaft aus. „Sollte (die Richterin) Chan auf Abwicklung entscheiden, könnte sich das auch auf andere Unternehmen auswirken“, sagt etwa Max Zenglein vom China-Institut Merics in Berlin gegenüber der „Tagesschau“. „Der Fall Evergrande zeigt auch, dass die Ära der großen privaten Immobilienentwickler in China zu Ende geht.“