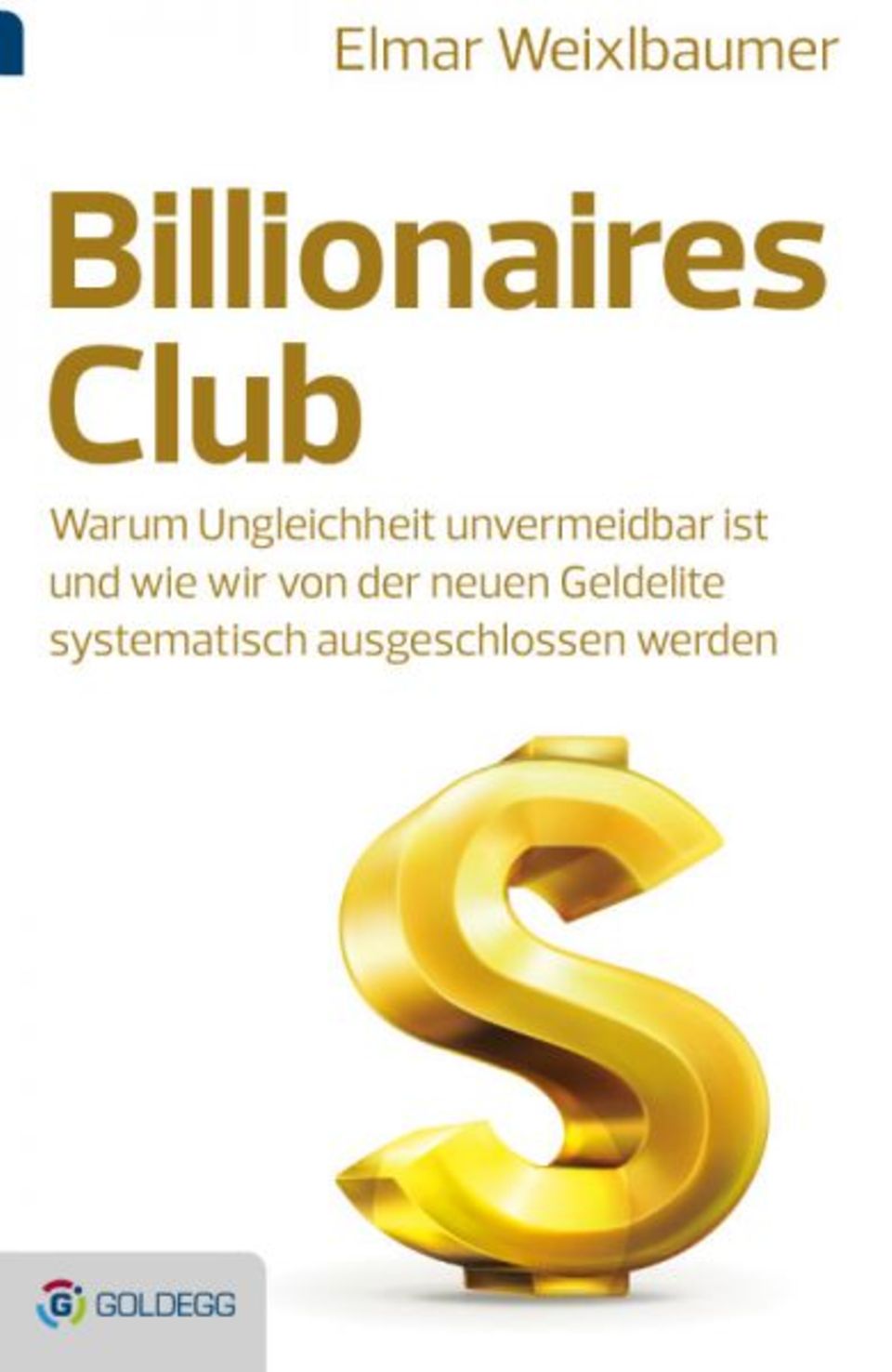Elmar Weixlbaumer arbeitet als Verleger und Manager. In seinen Publikationen beschäftigt er sich mit der Bildungssituation und gesellschaftlichen Strömungen. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Billionaires Club. Warum Ungleichheit unvermeidbar ist und wie wir von der neuen Geldelite systematisch ausgeschlossen werden“ im Goldegg Verlag Wien
Arm und Reich driften immer weiter auseinander, das ist unbestreitbar und nicht neu. Aber erst jetzt fällt das Augenmerk der breiten Öffentlichkeit auf dieses Phänomen. „Ungleichheit“ ist derzeit einer der meistdiskutierten ökonomischen Begriffe. Thomas Pikettys „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ hat diese Diskussion nicht losgetreten – es ist Ausdruck derselben. Doch jenseits seines wissenschaftlichen Bienenfleißes und seiner drastischen Schlüsse stellt sich die praktische Frage: Was können wir tun, um so vielen Menschen wie möglich eine würdige Existenz zu schaffen, die mehr sichert als das nackte Überleben.
Schlagzeilen über die „neue Armut“ und absurde Verdienste Superreicher sind an der Tagesordnung. Die 100 reichsten Menschen besitzen zwei Billionen US-Dollar – das Bruttonationaleinkommen von Großbritannien – und gleichzeitig verhungern täglich über 8000 Kleinkinder. Die durchschnittlichen Ersparnisse der Deutschen betragen 51.400 Euro, einer der niedrigsten Werte in Europa. 50.000 Euro kostet eine Nacht in der Royal Penthouse Suite im Hôtel Président Wilson in Genf.
Ohne stetige wirtschaftliche Verschärfung könnte man das einfach quittieren. In der Realität werden die Armen jedoch immer ärmer werden und dass freie Kapital fließt von der Mittelschicht zu den Superreichen. Damit diese dramatische Spirale die Gesellschaft nicht irgendwann sprengt, braucht es eine drastische Umverteilung. Wer aber soll die bezahlen? Neue Steuern für alle helfen letztlich den Reichen, bezahlen werden sie die Normalverdiener, und die Ungleichheit wird größer. Das ist keine Lösung.
Mathematisch unvermeidlicher Reichtum
Die Ursache dieser Häufung von Reichtum liegt jedoch weniger an der Gier, der Skrupellosigkeit oder dem Geschick der Reichen. Vielmehr treiben mathematisch beschreibbare Prozesse diese Umverteilung. Die Profiteure verhalten sich lediglich rollengemäß. Jeder Mensch strebt nach Sicherung und Mehrung seiner wirtschaftlichen Ressourcen. Klar, scheffeln tüchtigere (und manchmal gewissenlosere) Menschen mehr Vermögen als andere. Doch diese Charakterunterschiede erklären nicht die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich.
Die Hauptursachen dieser Ungleichheit sind das System aus Zinseszins, dem freien Spiel auf den Geldmärkten und die Möglichkeit der Börsen-Elite mit Insider-Deals andere Marktteilnehmer abzuzocken. Außerdem bietet Reichtum die exklusive Möglichkeit, hochgradig wirksame Steuersparmodelle zu nutzen, die Geringverdienenden nicht zur Verfügung stehen. Clevere Holdings in Luxemburg, Briefkastenfirmen in exotischen Steuerparadiesen, Schwarzgeldkonten auf Urlaubsinseln im Pazifik und Privatstiftungen, deren Gemeinnützigkeit nur die steuerlich geschützte Garantie einer großzügigen Apanage für Kinder und Kindeskinder garantiert: All dies sind die Ursachen dafür, dass der Reichtum der oberen Zehntausend exponentiell wächst, während das benötigte Kapital von der Mittelschicht abgesaugt wird.
Dieses System generiert Ungleichheit auch ohne die unterschiedlichen Begabungen und Neigungen der Menschen. Selbst eine simulierte Volkswirtschaft mit völlig identischen Vermögen seiner Bürger und einer einheitlicher Verzinsung erzeugt mathematisch belegbar rasch eine krasse Konzentration von Reichtum in den Händen weniger. Gibrats Gesetz (Robert Gibrat 1904–1980) beschreibt, dass das proportionale Wachstum von Firmen, Städten und auch Vermögen unabhängig von deren Größe ist. Der Anstieg eines Millionenvermögens um zehn Prozent ist demnach gleich wahrscheinlich wie das Wachstum eines kleinen Sparguthabens um zehn Prozent. Ein solches Setting erzeugt jedoch sehr rasch eine starke Kumulierung von Vermögen in der Hand weniger – auch in einer simulierten Volkswirtschaft, wo alle zu Beginn das Gleiche besitzen. Chancengleichheit führt somit rasch zu Ungleichheit im Besitz.
Ebenso spannend: Diese Regel gilt nicht nur für Kapitalismus und Marktwirtschaft, sondern in allen Gesellschaftsformen. Das war im alten Rom und im Feudalismus nicht anders, als es jetzt im kommunistischen China ist. In keiner Volkswirtschaft der Welt gibt es eine derart rasant ansteigende Zahl von Superreichen.
Gestoppt werden kann diese Entwicklung nur, wenn das System von außen massiv gestört wird. In der Vergangenheit übernahmen Kriege, Seuchen oder Wirtschaftszusammenbrüche diese Rolle. Doch auch wenn das System zurückgesetzt wurde – schon bald beginnt sich die Elite wieder abzukoppeln und das Spiel startet neu. Das hat auch Thomas Piketty richtig festgestellt.
Die Mittelschicht verliert den Anschluss
Heute stehen wir an der Schwelle einer neuen durch Reichtum definierten Monekratie, die die Tore hinter sich schließt. Privatschulen für 70.000 Euro im Jahr, abgeschottete Wohnbezirke, eine lebensverlängernde Privatmedizin, die der Mittelschicht verschlossen bleibt und vieles mehr: Die Differenzierung beginnt schon in frühester Kindheit. Soziales Umfeld und die Bildung des Elternhauses spalten die Gesellschaft. Intelligenz, Ausdrucksstärke, Sprachvermögen und logisches Denken werden im ersten Lebensjahr geprägt und korrelieren direkt mit dem Haushaltseinkommen. Untersuchungen zeigen, dass die geringere Intelligenz von Nachkommen wenig verdienender Haushalte der von Kindern Cracksüchtiger vergleichbar ist. Eine spätere Gesamtschule vermag hier nichts mehr zu reparieren.
Mit der Sprengung der Gesellschaft verschieben sich die Machtverhältnisse zugunsten der Elite. Eine monekratische Struktur bildet sich aus – mit einer kleinen Oberschicht, politischen Parteien als fremdgesteuerter Exekutive und einer breiten Masse von Zuarbeitern und Wertschöpfern. Letztere vermögen nicht mehr in politische Entscheidungen einzugreifen, die Demokratie verkommt zum Marionettentheater. Die USA sind hier Vorreiter. Eine Studie der Princeton University kam zu dem Ergebnis, dass der durchschnittliche Bürger praktisch keinen Einfluss mehr auf demokratische Entscheidungen hat. Die politische Willensbildung in den USA ist heute fast ausschließlich in der Hand von Lobbyisten, Banken und Industriellen. Eine Entwicklung, die sich genauso in Europa abzuzeichnen beginnt.
Selbsthilfe statt Sozialromantik
Sozialromantik und neue Steuern, wie Thomas Piketty sie fordert, kommen fast zu spät und sind wirkungslos. Die Elite ist längst zu einflussreich und hat ihre Vermögen in Sicherheit gebracht. Jede Umverteilungsmaßnahme geht nur zu Lasten der Mittelschicht. Der Ruf nach neuen Steuern ist Populismus. Maximal erreichbar sind multifaktorielle Maßnahmen mit meist indirekten Eingriffen: Verödung von Steuerparadiesen, Abschaffung von Gesetzen, die pseudo-gemeinnützige Privatstiftungen favorisieren, kostenfreie, hochwertige Bildung für alle statt diese in Elite-Internaten zu konzentrieren – aber auch Vermögenssteuern in durchsetzbarer Höhe und Eingriffe, die den Zinseszins stärker als den Zins besteuern sowie die Verzinsung reglementieren, also Unterschiede in der Verzinsung je nach Gesellschaftsschicht und Vermögensgröße unterbinden.
Doch das muss bald greifen. Der Einfluss des Geldadels auf die Politik nimmt rasant zu, und die Manipulation des Wahlvolks tut den Rest. Diese Propaganda lässt den Bürger glauben, dass sichere Vermögen der Reichen genug abfallen lassen für alle. Dummerweise fallen aber keine Kobe-Steaks vom Himmel, sondern lediglich Brotkrumen.
Ein effizientes Vermögensmanagement muss her, um aus der Falle geldvernichtender Sparbücher auszubrechen. Drohende Negativzinsen auf Sparguthaben zeigen, dass üblichen Sparkonzepten nicht mehr zu vertrauen ist. Was Otto Normalverbraucher an Zinserlösen erzielen kann, liegt in aller Regel unterhalb der Inflationsrate, während das tote Kapital der Reichen hohe Prozentsätze darüber erzielt. Auch das führt dazu, dass die Mittelschicht immer weniger und die Oberschicht immer mehr in den Taschen hat.
Die größten Hindernisse der Mittelschicht, wenigstens zu einem gewissen Reichtum zu kommen, sind Autos, Eigenheim, Scheidungen und ungeplanter Konsum – Fehler, die sich leicht vermeiden ließen. Viele kleben an der Hoffnung, in einer Welt unerreichbarer Milliardäre mit etwas Glück die eine oder andere Million erwirtschaften zu können. Aber auch hier gilt: Geld ist eine begrenzte Ressource, und was die einen bekommen, verlieren die anderen. Wenn das Wachstum erlahmt, das frische Werte im System produziert, saugt der Reichtum das Geld von der Masse an. Er wird zum schwarzen Loch, das alles verschlingt, was nicht bereits den Reichen der Reichen gehört.