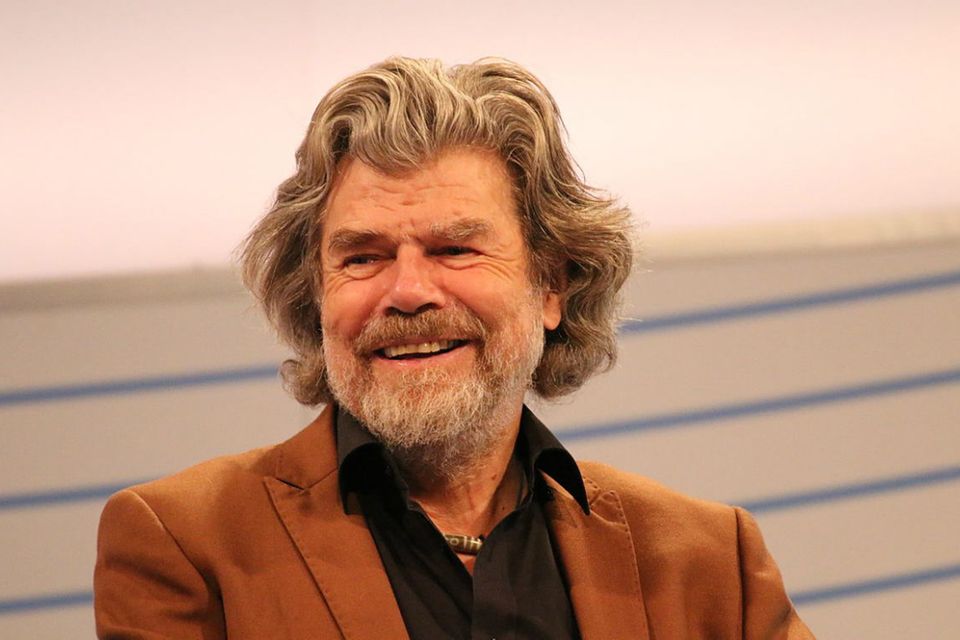Wie aggressive Haie kreisen die Yachten vor der Startlinie, bringen ihr Kielwasser zum Kochen. Noch fünf Minuten, dann beginnt die neunte und letzte Wettfahrt der Rolex-TP52-Weltmeisterschaft. Es sind die wichtigsten Minuten der Regatta, dabei hat das Rennen noch gar nicht angefangen. Im Kampf um die beste Startposition schlagen die Steuermänner Haken, wenden und halsen, bedrängen den Gegner und versuchen, den Wind aus den Kohlefasersegeln der Konkurrenten zu kapern.
„Beim Start werden die Karten ausgegeben“, sagt Robert Scheidt. „In dem Moment gibt es keine Gnade, keine Freunde.“ An fünf Olympischen Spielen hat der Brasilianer teilgenommen, holte je zweimal Gold und Silber und einmal Bronze. Zweimal war er „Weltsegler des Jahres“. Jetzt führt er als Taktiker das brasilianische Team „Onda“.
Eben noch baumelten Crewmitglieder, die sogenannten Windspotter, hoch oben in den Masten, um den Atlantik vier Meilen vor der portugiesischen Küste bei Cascais nach Böen abzusuchen. Die Yachten trackten die exakte Position der beiden Motorboote, die die rund 200 Meter lange Startlinie bilden. Mit den Daten füttern sie eine speziell entwickelte App, die die Taktiker der Teams auf den Smartphones an ihren Armbinden im Sekundentakt kontrollieren wie Teenager ihre Whatsapp-Nachrichten.
Wind, Richtung, Speed, alles wird erfasst. Kameras filmen die Segeleinstellung, den Trimm, die App wertet die Daten aus. Der Wind bläst in Böen mit 25 Knoten, sechs Beaufort – das Limit für die leichten TP52-Boote mit ihren gewaltigen Segeln. Legt der Wind zu, muss abgebrochen werden. Wellen wummern wie Hammerschläge auf die steifen Karbonrümpfe. Schoten ächzen unter der tonnenschweren Last der Segel, es klingt ein bisschen wie Walgesang.
Klassentreffen der Besten
Die TP52 World Championship ist wie ein Klassentreffen der besten Segler der Welt. Olympioniken und Weltmeister segeln auf den neun Yachten, deren Crews aus bis zu 14 Mitgliedern bestehen, maximal sieben Profis dürfen an Bord sein. Als „der kleine America’s Cup“ gilt die TP52-Weltmeisterschaft. Die Teams sind teilweise identisch, aber es gibt eine Besonderheit: Meist stehen hier die Bootseigner selbst am Steuer, millionenschwere Kapitäne, auf See wie in der Wirtschaft.
Zum Beispiel Hasso Plattner. Der SAP-Mitgründer nimmt mit seiner „Phoenix“ in dieser Saison unter der Flagge Südafrikas am Rennzirkus teil. Am Ruder wechselt er sich mit seiner Tochter Kristina ab. Dabei ist auch der Hamburger Immobilieninvestor Harm Müller-Spreer, der Weltmeister von 2017. Andere begeisterte TP52-Segler sind Prada-Chef Patrizio Bertelli mit seiner „Luna Rossa“, der argentinische Pharma-Clan Roemmers mit der „Azzurra“ und Doug DeVos mit seiner „Quantum“. DeVos ist Präsident des US-Drogeriewarenkonzerns Amway, seine Schwägerin Elisabeth Bildungsministerin im Kabinett Trump.
Nicht bei der diesjährigen Weltmeisterschaft am Start, aber Teilnehmer der 52 Super Series, in deren Rahmen die WM stattfindet, sind der russische Oligarch Wladimir Liubomirow und der französische Recyclingkönig Jean-Luc Petithuguenin. Ausgetragen wird die Serie in Europa und den USA, 13 Teams aus neun Ländern nehmen teil. Ausgestiegen ist 2017 der schwedische Skype-Erfinder Niklas Zennström, nachdem er fünf Jahre lang Präsident der TP52-Bootsklasse war.
Am Morgen des WM-Finaltags sieht das Team „Quantum Racing“, das 2021 für den New York Yacht Club beim America’s Cup starten wird, bereits wie der sichere Sieger aus. Es hat sieben Punkte Vorsprung auf den Verfolger „Azzurra“. Doch im ersten Rennen patzt die Mannschaft um die Segellegenden Dean Barker und Terry Hutchinson – nur Platz fünf, die „Azzurra“ siegt, der Vorsprung schmilzt auf drei Punkte. Titelverteidiger Müller-Spreer liegt bereits abgeschlagen auf Platz sechs, Hasso Plattner noch dahinter auf Platz acht.
Müller-Spreer nimmt es sportlich. Der Immobilienmogul – ihm gehören unter anderem in Hamburg das Elbchaussee-Schloss „Villa de Freitas“, in Berlin das Spreedreieck an der Friedrichstraße mit dem Tränenpalast sowie Häuser an den Hackeschen Höfen und das Französische Palais Unter den Linden – weiß, dass er gegen die besten Segler der Welt antritt. „Jedes Rennen ist wie ein neues Leben. Jeder kann gewinnen“, sagt der 55-Jährige, der bereits in den 80er-Jahren als einer der talentiertesten Segler Deutschlands galt und mehrmals Europa- und Weltmeister im Drachen wurde. Jetzt segelt er in der Champions League. „Die Leistungsdichte der Teams ist enorm, und die Yachten haben dank der Box Rule die gleichen Chancen“, sagt Müller-Spreer. Das gefällt ihm. „Entscheidend ist nur, wie gut die Crew segelt, und nicht, wer das dickste Bankkonto hat.“
Die Box Rule gibt die Maße der puristischen Yachten vor: Länge, Breite, Gewicht, Masthöhe und Segelfläche. Trotzdem ist die TP52 keine typische Einheitsklasse, in der alle Parameter exakt gleich sind. Beim Trimm des Boots und bei technischen Details haben die Teams freie Hand. Die knapp 16 Meter langen Karbongeschosse sind extrem wendig, leicht und sehr schnell. Unter dem riesigen Spinnaker laufen sie vor dem Wind über 20 Knoten. „Die TP52-Serie ist die beste Segelplattform der Welt“, sagt stolz Agustin Zulueta, der Leiter der Rennserie.
Formel 1 der Meere
Erstmals wurden TP52-Regatten in Europa im Jahr 2005 ausgetragen. Die selbst ernannte „Formel 1 der Meere“ boomte. Anfangs. Dann aber wechselte der America’s Cup von Monohulls, also Einrümpfern, auf Katamarane. Die TP52 verlor damit ihre Bedeutung als vorbereitendes Training für das alle vier Jahre stattfindende Großevent. 2011 wurde in der TP52-Klasse die MedCup-Serie eingestellt, auch der Sponsor stieg aus.
Vor allem Skype-Gründer Niklas Zennström ist die Renaissance der Bootsklasse zu verdanken. Zusammen mit anderen Multimillionären belebte er die Regatten, verzichtete auf Sponsoren. Das Ziel: eine Regattaserie auf höchstem technischem und sportlichem Niveau zu etablieren, eine sogenannte „Super Series“. 2014 startete sie durch. Dem Reiz der schnellen Yachten verfielen immer mehr Segelenthusiasten – vor allem als bekannt wurde, dass der America’s Cup zurück auf Monohulls wechselt.
Vergangenes Jahr stieg Rolex bei der 52 Super Series als Zeitnehmer, Partner und Hauptsponsor der WM ein. Der Schweizer Luxusuhrenhersteller hat eine 60-jährige Tradition im Segelsport. Uhrenklassiker wie die „Yacht-Master“ wurden für den Regattasport entwickelt, auch die „Submariner“, eigentlich eine Taucheruhr, ist beliebt bei Hochseeseglern. Rolex sponsert weltbekannte Offshore-Regatten wie das Sydney Hobart Yacht Race und das Fastnet Race oder den Maxi Yacht Rolex Cup, zusammen mit dem Weltseglerverband kürt der Uhrenhersteller den „Segler des Jahres“. Für den Brasilianer Robert Scheidt eine perfekte Symbiose: „Im Segelsport geht es um genaues Timing. Und um Präzision. Die Crew muss funktionieren wie ein Uhrwerk, ein Rädchen greift ins andere.“
Es gibt noch eine Parallele zwischen Rolex und dem Yachtsport: Über Zahlen wird nicht gesprochen. Details über die Boote erfährt man nur hinter vorgehaltener Hand. Eine segelfertige TP52 koste rund 3 Mio. Dollar, verrät ein Sportler. Der Unterhalt verschlingt weitere Millionen pro Jahr.
Ein komplettes Team besteht aus bis zu 30 Mitgliedern. Neben den Bootsbesatzungen gibt es Segelmacher, Logistiker, Techniker, die sich vor Ort um Reparaturen kümmern, ein Team, das die Rennen mit einem Speedboot begleitet. Kameras filmen jeden Handgriff an Bord, Drohnen surren über dem Schiff. Nach jedem Rennen werden die Bilder analysiert. Die Teams reisen mit zwei großen Containern, mit integrierter Segelmacherei und Werkstatt. Nach den Rennen werden die Yachten mit Containerschiffen zum nächsten Austragungsort transportiert. In der Regel gibt es pro Saison vier Rennen in Europa und zwei in den USA.
Die Profisegler sind Söldner zur See. Sie werden für eine Saison verpflichtet, aber auf Tagesbasis bezahlt. Wie in der Formel 1 ist Training zwischen den Wettkämpfen verboten. Nur drei Tage vor den Regatten dürfen die Teams segeln. Der Tagessatz für gute Profisegler liege im vierstelligen Bereich, sagt ein Insider. „Die Top-Segler verdienen sogar fünfstellig.“ Nach einer Regatta fliegen die Profis meist direkt zur nächsten, wo sie in anderen Klassen und für andere Teams starten. „Auf dem Wasser sind wir Feinde, an Land Freunde“, sagt Scheidt. „Bei der einen Regatta sind wir Gegner, bei der nächsten Partner.“
Jeder Handgriff sitzt
Im letzten Rennen bei der Weltmeisterschaft in Portugal ist die „Quantum“ der wendigste Hai, sie erwischt eine gute Startposition. Die „Azzurra“ hängt sich in ihr Kielwasser. Hoch am Wind peitschen die Yachten durchs aufgewühlte Meer, Zweimeterwellen überrollen das Deck. Müller-Spreer liebt solche Bedingungen, wenn er immer wieder „gewaschen“ wird, wie er sagt. So kann er sich am besten konzentrieren.
Ein Rennen dauert zwischen 45 und 55 Minuten. Gestartet wird gegen den Wind, die Yachten kreuzen zu einer Wendemarke, die an diesem Tag 2,2 Seemeilen entfernt liegt. Die Schoten schreien vor Spannung, die Wanten, die den Mast halten, jammern im Wind. Kleine Spoiler reduzieren die Geräusche, damit die knappen Kommandos der Taktiker zu verstehen sind. Der Rest der Crew schweigt. „Ein ruhiges Boot ist ein schnelles Boot“, sagt Scheidt.
Die Mannschaft sitzt auf der hohen Kante, lehnt sich weit über die Bordwand, um dem Druck im Segel möglichst viel Gewicht entgegenzustemmen. Jeder Handgriff ist einstudiert, jede Position ausgemessen. Mit jeder Bö, jeder kleinen Kursänderung verlagern die Segler ihr Gewicht, um den bestmöglichen Trimm zu ermöglichen.
An der Wendemarke katapultieren die Grinder, kräftige Männer an großen Kurbeln, den Spinnaker in die Höhe. Nach nur drei Sekunden bläht sich das knapp 300 Quadratmeter große Tuch wie ein Ballon, zieht die Yacht übers Wasser, bringt sie ins Gleiten. Die Crew quetscht sich ins Heck. An der zweiten Wendemarke in der Nähe des Starts wird der Spinnaker wieder eingeholt. Ein kritischer Moment. Wie ein geplatzter Ballon fällt das Segel in sich zusammen, wenn das Fall an der Mastspitze gelöst wird. In Bruchteilen von Sekunden wird das Segel unter Deck gezogen. Nicht immer klappt das Manöver. Landet der Spinnaker im Wasser, ist das Rennen verloren. Müller-Spreer hat Pech. Das Fall verhakt sich, in der letzten Runde segelt die „Platoon“ ohne Spinnaker dem Feld hinterher.
Die „Quantum“ gewinnt vor der „Azzurra“ das Rennen – und damit auch die Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Müller-Spreer landet auf dem sechsten Platz. Im April erst hatte er seine neue Yacht bekommen, er muss sich noch an sie gewöhnen. „Ein neues Boot reagiert komplett anders“, sagt er. Immerhin konnte er in einem der neun WM-Rennen auf den zweiten Platz segeln. Müller-Spreer ist zuversichtlich, wieder zur Spitze aufzuschließen. „Am Ende muss man sagen, da draußen ist nur Wasser. Und keiner kann übers Wasser laufen.“