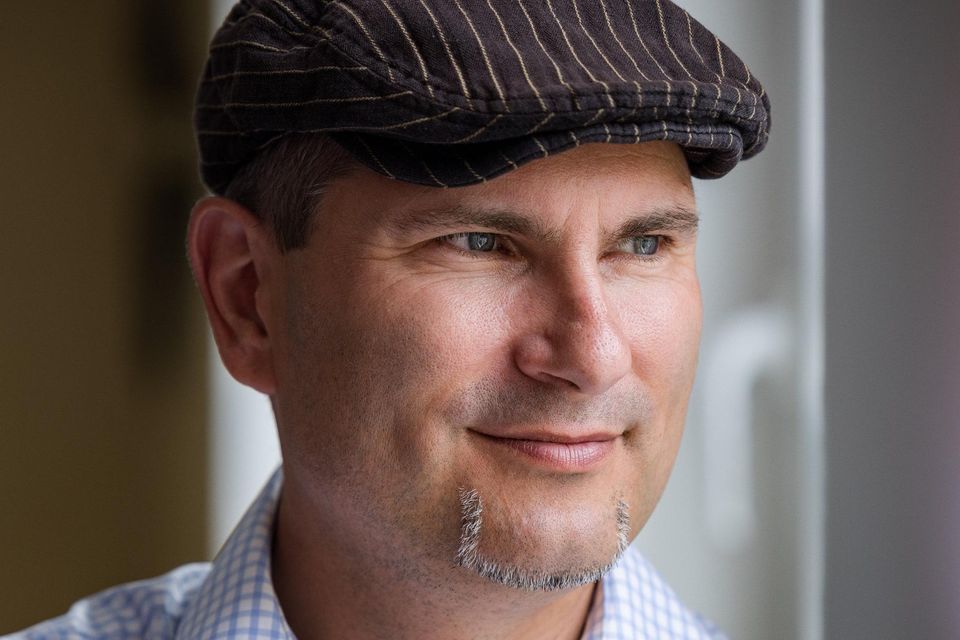„Was wir auch tun: Wir kriegen unsere Leute einfach nicht aus dieser Silodenke heraus.“ Der Frust in der Stimme des Top-Managers eines Dax-Konzerns, mit dem ich vergangene Woche sprach, war nicht zu überhören.
Die Klagen über das Silodenken in Unternehmen, das die Wertschöpfung massiv behindert, reißen nicht ab – und das schon seit Jahren. Silodenken scheint mir zur Volkskrankheit in Unternehmen geworden zu sein.
Eine Frage der Therapie
Das Bild der Volkskrankheit kommt nicht von ungefähr: Die Klagen über zum Beispiel Bluthochdruck reißen auch nicht ab, obwohl die Diagnose meist leicht ist und die Erkenntnisse über Entstehung sowie wirksame Gegenmaßnahmen schon lange auf dem Tisch liegen.
Doch sowohl beim Silodenken als auch beim Bluthochdruck werden diese Erkenntnisse in der Umsetzung weitgehend ignoriert.
Und so verfolge ich halb amüsiert, halb entsetzt, wie die Firmen statt zu wirksamen Mitteln immer wieder zur Familienpackung Motivan greifen, um ihren Mitarbeitern Kooperationswillen aufzusalben – obwohl sie bereits mehrfach die Erfahrung gemacht haben, dass derartige Appelle auch nach zehnfachem Auftragen keine Änderung bewirken. Im Gegenteil, denn der Leidensdruck wird dadurch tendenziell noch größer.
Eine Frage des Leidens
In einer zugegeben etwas älteren Studie von Hays habe ich gelesen, dass 86 Prozent aller Mitarbeiter in Teams Konflikte in der Priorisierung von Linien- und Projektaufgaben beobachten – ein typischer Effekt von Silodenken. Und 76 Prozent empfinden das Management von organisatorischen Schnittstellen als enorm aufwendig – dito.
Solche Zahlen sind natürlich kein Beweis, aber sie unterstreichen die weite Verbreitung dieses Leidens. Ich behaupte sogar, dass – wie ich vor nicht allzu langer Zeit an dieser Stelle ausgeführt habe – der angebliche Fachkräftemangel mit einem Schlag zu halbieren wäre, wenn die Kapazitäten der vorhandenen Fachkräfte nicht unter anderem durch Auswüchse des Silodenkens verschwendet würden.
Grund genug, mir Gedanken zu machen, warum die Unternehmen nach wie vor konsequent auf unwirksame Gegenmaßnahmen setzen. Ich bin dabei zu einem Schluss gekommen, und der lautet: Es liegt am Denken.
Eine Frage des Denkens
Aber anders, als die meisten vermuten, liegt es nicht am störrischen Festhalten der Mitarbeiter am Silodenken. Es liegt stattdessen an folgender eingerasteten Grundannahme im Denken vieler Führungskräfte: „Ein Unternehmen besteht aus Menschen.“
Diese Annahme ist intuitiv logisch und absoluter Mainstream: Sie entspricht dem, was ein Manager heute zu sagen hat, wenn er nicht als menschenverachtender Chauvi dastehen möchte. Deshalb findet sich auch garantiert in jedem Leitbild ein Satz in der Art wie: „Unser Unternehmen hat nur deshalb so herausragenden Erfolg, weil es so herausragende Menschen beschäftigt.“
Das impliziert, dass die Menschen sind, wie sie sind: entweder top oder flop. Und wenn die Ergebnisse einer Zusammenarbeit eher flop sind, dann muss es an mindestens einem der Beteiligten liegen, der nicht will oder nicht fähig ist. Den gilt es, ausfindig zu machen und ihn dann zur Brust zu nehmen. Zum Beispiel durch Motivan aufsalben.
Dies ist allerdings eine völlig ungenügende Sichtweise auf ein Unternehmen, denn sie führt dazu, dass ein entscheidender Einflussfaktor auf die Zusammenarbeit komplett übersehen wird.
Eine Frage des Kontexts
Richtig ist, dass in einem Unternehmen Individuen zwecks Kooperation zusammenkommen. Das Unternehmen entsteht jedoch nicht durch die biologische oder virtuelle Anwesenheit der Menschen, sondern durch deren spezifische Kommunikation miteinander. Und diese Kommunikation wiederum prägt das Verhalten.
Denn WIE ein Individuum sich verhält, ist extrem kontextabhängig. Ein kleines Beispiel mag das illustrieren: Derselbe Mensch, der im Fußballstadion lauthals seine Begeisterung für einen Stürmer herausbrüllt, wird das in der Oper nicht tun, selbst wenn der Tenor hervorragend ist.
Wenn Sie also an dem Verhalten der Menschen in Ihrem Unternehmen etwas verändern wollen, gilt es nicht die Menschen, sondern den Kontext zu verändern.
Wem das zu abstrakt klingt, dem möchte ich einen praktischen Fall schildern.
Eine Frage der Zusammenarbeit
Stellen Sie sich vor, Annegret aus der Fachabteilung XY wendet sich an Justus von HR: Es seien mal wieder Schulungen in Sachen Vertriebskompetenz nötig, und die Personalabteilung möge diese bitte organisieren. Vielleicht hat Justus noch ein paar Fragen, aber vielleicht auch nicht. Jedenfalls machen er und seine Kollegen sich auf die Suche nach entsprechenden Dienstleistern, während die Fachabteilung in Person von Annegret ihrem Tagewerk nachgeht und auf Justus’ Antwort wartet.
Einige Zeit später kommt dieser dann freudestrahlend mit einem nach allen Regeln der HR-Kunst ausgewählten Angebot um die Ecke – und ist völlig überrascht, dass Annegret nicht begeistert ist. Stattdessen mäkelt sie an verschiedenen Ecken des Schulungskonzepts herum und bittet um Nacharbeit.
Das Spiel wiederholt sich noch ein- bis zweimal, bis Annegret das Angebot schließlich annimmt – nicht weil es nun perfekt passt (das tut es immer noch nicht), sondern aus Höflichkeit oder weil doch bereits so viel Arbeit geleistet worden ist.
Der Erfolg der Schulung lässt zwangsläufig zu wünschen übrig. Am Ende sind beide Seiten maximal frustriert, obwohl sowohl Justus als auch Annegret sich redlich bemüht haben. Wenn es schlecht läuft, werden zusätzlich noch Schuldzuweisungen laut: Justus hätte sich nicht richtig angestrengt oder Annegret sei halt noch ein bisschen ‚old-school‘.
Eine Frage der Symmetrie
Das ist ein typisches Beispiel für eine sogenannte asymmetrische Schnittstelle: Eine der beiden Seiten muss, strukturell gesteuert, ungleich mehr in die Kollaboration hineingeben als die andere. In klassischen Silos ist das der Normalfall.
Was im Unterschied dazu eine symmetrische Schnittstelle ist, können Sie tagtäglich in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beobachten: Diese geben in den gemeinsamen Topf der Kollaboration etwas, was beide als gleichwertig betrachten: der Anbieter seine Leistung und der Käufer die angemessene Zahlung. Gibt einer von beiden zu wenig – zum Beispiel in Form von schlechter Leistung oder schlechter Zahlungsmoral – endet die Zusammenarbeit schnell.
Diese Beendigung der Zusammenarbeit geht im Unternehmen in der Regel eben nicht. Und Appelle an eine bessere Zusammenarbeit ändern an der Asymmetrie auch nichts. Im Gegenteil.
Bei Annegret und Justus springt inzwischen sofort der Zynismus-Generator an, sobald sie hören: „Lasst uns einfach mehr miteinander reden, dann klappt das beim nächsten Mal besser.“ Beide wissen aus Erfahrung, dass dieses Rezept gegen die Volkskrankheit Silodenken nicht hilft.
Wie sollte es auch helfen, wenn der strukturelle Kontext – die eigentliche Ursache – bleibt, wie er ist.
Genau da müsste ein Unternehmen ansetzen.
Eine Frage der Heilsamkeit
Eine Symmetrisierung könnte zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass Justus den Ball zunächst an Annegret zurückspielen darf: „Ihr braucht eine Schulung in Vertriebskompetenz? Prima, dann schreibt ihr das Curriculum en Detail dafür, und auf dieser Basis suchen wir euch den Dienstleister, der dieses Curriculum mit euch durchzieht.“
So muss und darf die Fachabteilung ihren Teil liefern, damit HR ihren Teil liefern kann. Das fördert die Kooperation strukturell und verringert in der Folge das Silodenken.
Es ist von Schnittstelle zu Schnittstelle verschieden, wie eine Symmetrisierung konkret aussehen kann. Dies jeweils herauszufinden, ist anstrengend und nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, dafür jedoch ursächlich heilsam.
Eine Frage der Impfung
So manche Volkskrankheit von früher, wie Polio oder Tetanus, gilt heute als weitgehend ausgerottet. Beim Silodenken kann ich Ihnen da leider wenig Hoffnung machen, schon allein deshalb, weil es gar nicht sinnvoll wäre, alle Silos pauschal aufzulösen. Was Sie auf jeden Fall tun können, ist das Leiden am Silodenken durch die richtigen Maßnahmen lindern …