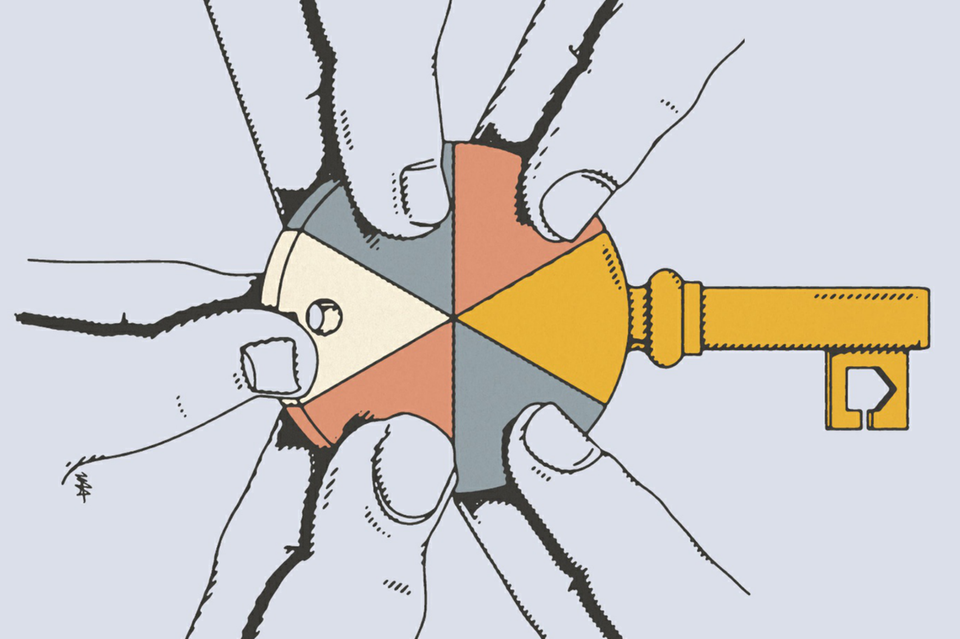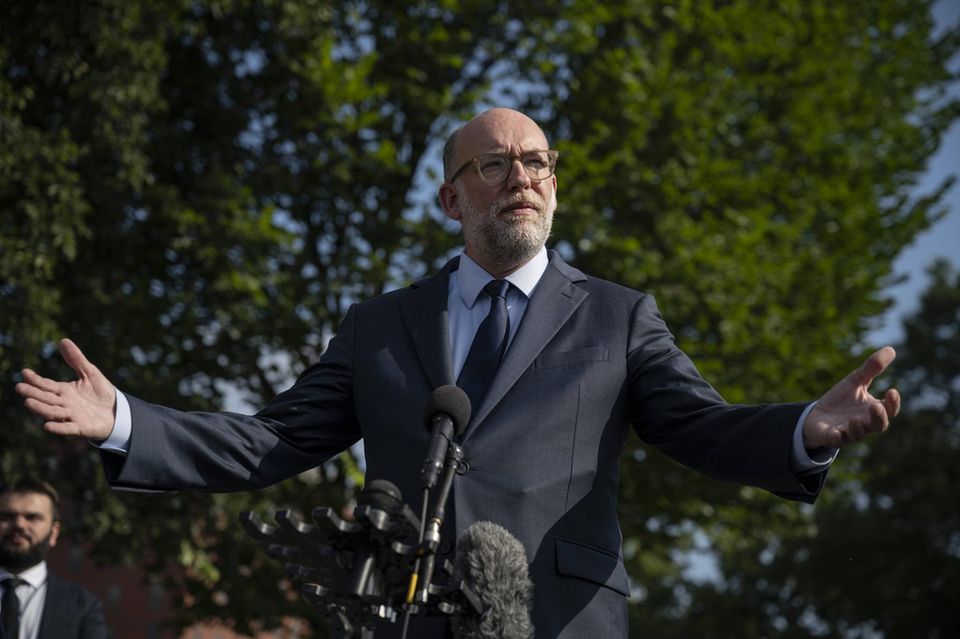Vielleicht leben wir im digitalen Panopticon und haben es nur noch nicht gemerkt, doch dazu später mehr. An deutlichen Worten hat es in der Vergangenheit jedenfalls nicht gefehlt: „Wenn Sie etwas tun, was niemand wissen sollte, sollten Sie es lieber gleich bleiben lassen", riet Google-Chef Eric Schmidt den rund 360 Millionen Nutzern seiner Suchmaschine und Facebook-Chef Mark Zuckerberg proklamiert schon lange, das Zeitalter der Privatsphäre sei sowieso vorbei.
Doch was das für ihr Alltagsleben konkret bedeuten könnte, realisieren viele Menschen offenbar erst jetzt, in diesen Wochen der Enthüllungen über Späh-Programme wie „PRISM“, mit denen der amerikanischen Geheimdienst NSA ihre Daten auswertet. Damit werde klar, dass wir in einer Welt von Doppelagenten leben, die uns Suchergebnisse, Bücher und Freundschaften verschaffen und im Gegenzug jeden einzelnen unserer Schritte aufzeichnen, speichern und weitermelden, konstatierte die FAZ: „Unser Verhalten soll prognostizierbar werden. Ein Außen gibt es nicht mehr, wer nicht mitspielt, ist verdächtig.“
Während viele das Phänomen offenbar nur in den USA vermuteten, US-Präsident Obama die Erfolge der Datenüberwachung bei der Terror-Abwehr hervorhob und Bundeskanzlerin Merkel bei dem Thema eher „Neuland“ sah, meldete der Spiegel, dass auch der Bundesnachrichtendienst plane, das Internet stärker zu überwachen und dafür 100 Mio. Euro investieren wolle. An den wichtigsten Knotenpunkten für den digitalen Verkehr durch Deutschland habe der BND eigene technische Zugänge eingerichtet, erklärte das Nachrichtenmagazin mit einem anschaulichen Vergleich: „Sie arbeiten wie eine Polizeikontrolle auf der Autobahn: Ein Teil des Datenstroms wird auf einen Parkplatz umgeleitet und kontrolliert. Kopien der herausgewinkten Daten wandern direkt nach Pullach, wo sie genauer untersucht werden." Im Jahr 2011 wurden vom BND insgesamt 2,875 Millionen E-Mails, Telefonate oder Faxe abgefangen – die Öffentlichkeit in Deutschland hat das bislang nicht besonders aufgeregt.
Auch aus England kamen diese Woche weitere peinliche Enthüllungen aus der Welt der Datenspionage. Demnach hat der britische Geheimdienst 2009 die Teilnehmer zweier G20-Gipfeltreffen in London ausgespäht, deren Computer überwacht und Telefonanrufe abgehört, berichtete der Guardian. Zusätzlich seien einige Delegationen auch in Internetcafés gelockt worden, die der Geheimdienst extra eingerichtet habe, um den den E-Mail-Verkehr und Tastatureingaben zu überwachen. Besonders pikant: Opfer der Überwachung waren auch Delegationen verbündeter Staaten wie Südafrika oder der Türkei. Dabei habe der Geheimdienst eine neue Technik eingesetzt, mit der in Echtzeit jedes Telefonat angezeigt werden konnte und auch, wer mit wem telefoniert. Die Erkenntnisse der Geheimdienst-Analysten seien dann der britischen Delegation übergeben worden. Schwer vorstellbar, wie solche Gipfeltreffen künftig ablaufen sollen, wenn jeder jeden auszuspionieren versucht und dazu alle technischen Raffinessen anwendet.
Wie sich Gesellschaften verändern, in denen Privatheit zum Luxus und die massenhafte Überwachung Alltag wird, ist nicht erst seit „PRISM“ eine wichtige Frage. Es gibt dazu interessante Erkenntnisse aus der Vergangenheit. In seinem Buch „Überwachen und Strafen beschrieb der französische Philosoph Michel Foucault das Prinzip des Panopticon, wie es zum Bau von Gefängnissen im 18. Jahrhundert entwickelt wurde: An der Peripherie ein ringförmiges Gebäude mit offen einsehbaren Zellen, darin die zu überwachenden Menschen - und im Zentrum des Rings ein Beobachtungs-Turm. Die Gefangenen wissen in dieser Struktur nie, ob sie gerade beobachtet werden, müssen aber jederzeit davon ausgehen. Der Effekt des panoptischen Konzepts ist eine tiefgreifende Verhaltensänderung der Beobachteten unter der potenziell permanenten Kontrolle des allumfassenden Blickes. Es gehe bei diesem Prinzip, dass sich auf alle möglichen Gesellschaftsbereiche anwenden lasse, um einen „gesichtslosen Blick, der den Gesellschaftskörper zu seinem Wahrnehmungsfeld macht: Tausende von Augen, die überall postiert sind; bewegliche und ständig wachsame Aufmerksamkeiten“, schrieb Foucault. Die Beobachteten kontrollieren sich dadurch praktisch selbst: „Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus; er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung.“
Nichts anderes meint Google-Chef Eric Schmidt, wenn er Bürgern rät, lieber ihr Verhalten zu ändern als etwas zu tun, was niemand wissen sollte. Schmidt weiß, wovon er spricht - er sitzt im Zentrum, im Beobachtungsturm. Wir leben in den Zellen der Peripherie, im digitalen Panopticon – vielleicht fangen wir gerade an, es zu merken.
Foto: © Loidys Carnero; Trevor Good