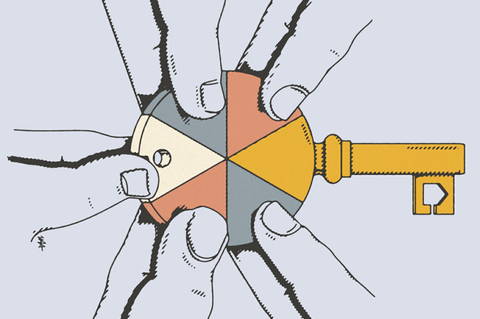Die ideale Altersvorsorge? Rund zwei Drittel der jungen Deutschen zwischen 18 und 24 und auch die Mehrheit aller Deutschen hat darauf eine klare Antwort laut Umfragen: Die eigene Immobilie. 43 Prozent aller Deutschen, die bisher noch zur Miete wohnen, streben demnach den Erwerb einer Immobilie an. Das geht aus einer repräsentativen Befragung im Auftrag der Hannoverschen Lebensversicherung hervor, die mit Blick auf das Ergebnis kaum befangen sein dürfte in Sachen Immobilien.
Tatsächlich war die Gelegenheit noch nie so günstig wie jetzt über die eigenen vier Wände Vermögen aufzubauen und für das Alter vorzusorgen – und das trotz der jüngst deutlich gestiegenen Immobilienpreise vor allem in Großstädten und den vielen Warnungen vor Preisblasen. Zwar sind die Immobilienpreise in Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg in den letzten zehn Jahren um rund die Hälfte gestiegen und der größte Teil dieses Anstiegs fiel in die vergangenen fünf Jahre.
Die Immobilienpreise sind jedoch nur einer von drei wichtigen Faktoren, wenn es um die Frage geht, ob der Kauf oder Bau einer Immobilie lohnt - die anderen beiden sind das Einkommen und das Zinsniveau. Weil in Deutschland sowohl das Einkommen steigt als auch die Zinsen deutlich gesunken sind – Immobilienkredite mit zehnjähriger Zinsbindung gibt es laut der FMH-Finanzberatung Mitte März bei entsprechender Bonität für im Schnitt lediglich 1,3 Prozent Zins - werden Immobilien „erschwinglicher als jemals zuvor“, wie der Immobilienverbands IVD jüngst erklärte. Zu ähnlichen Ergebnissen kam die Researchabteilung der Deutschen Bank in einer Studie von Ende Januar. „Das Verhältnis von Hauspreisen zu Einkommen und Hauspreisen zu Mieten liegt derzeit zehn Prozent unter den jeweils langfristigen Durchschnittswerten“, so die Analysten.
Angst vor einer Preisblase ist unbegründet
Auch im Lichte der Teuerungsrate der vergangenen Jahre und vor allem im internationalen Vergleich sieht der jüngste Preisanstieg weit weniger dramatisch aus. Nach Berechnungen der Industrieländerorganisation OECD haben die realen – also inflationsbereinigten – Immobilienpreise in Deutschland noch immer nicht wieder das Niveau von Mitte der 90er-Jahre erreicht und liegen selbst unter den Preisen, die Ende der 70er-Jahre gezahlt werden mussten. „Stabil und kaum besorgniserregend“ sei daher die Situation am Immobilienmarkt, urteilten die Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in einer großen Studie zur Preis- und Mietentwicklung.
Und selbst die für ihre kritische Haltung bekannte Bundesbank sorgt sich kaum. „Ist das nun eine Preisblase? Für Deutschland als Ganzes lautet die Antwort: nein“, erklärte ihr Vorstandsmitglied Andreas Dombret Ende Januar in einer Rede. Der Anstieg der Preise spiegle eher einen Aufholprozess nach einer jahrelangen, schwachen Entwicklung wider.
Doch wie geht man den Immobilienkauf am besten an? Kluge Käufer und Bauherren nähern sich dem Thema von der Risikoseite. Wichtige Fragen sind: Wie sicher ist mein Arbeitsplatz und wie wahrscheinlich – sei es aus beruflichen oder privaten Gründen – nochmals umziehen zu müssen? Denn der Verkauf einer noch nicht abbezahlten Wohnung ist mit finanziellen Risiken verbunden, vor allem in eher ländlichen Regionen mit geringem Zuzug. Nebenkosten von derzeit bis zu 15 Prozent der Kaufpreise belasten die Wirtschaftlichkeitsrechnung zusätzlich.
In einem zweiten Schritt können potenzielle Käufer ermitteln, wie hoch die monatliche Kreditrate sein darf. Verbraucherschützer und Banken raten je nach Risikoneigung dazu, nicht mehr als 40 oder maximal 50 Prozent des Nettoeinkommens anzusetzen, welches auch in Krisenzeiten zur Verfügung steht – und zu berücksichtigen, dass auch für das Eigenheim Nebenkosten wie Hausgeld, Versicherung, Steuern anfallen und vor allem Rücklagen für Instandhaltungen und Renovierungen gebildet werden müssen. Daraus ergibt sich ein monatliches Budget für Zins und Tilgung und daraus – in Verbindung mit dem angesparten Eigenkapital von idealerweise mindestens 20 Prozent der geplanten Kaufsumme – der realistische Preisrahmen für einen Immobilienerwerb einschließlich Nebenkosten und vor allem Einrichtung.
Kaufen lohnt sich heute schneller als Mieten
Für das Projekt der eigenen vier Wände gerade jetzt gibt es zudem einen gewichtigen Grund: Die rekordniedrigen Zinsen. Beim Vermögensaufbau über Wertpapiere oder Versicherungsprodukte arbeiten sie gegen den Sparer – für zehnjährige Bundesanleihen gibt es derzeit etwa nur 0,2 Prozent Zinsen pro Jahr. Beim Immobilienerwerb sorgen sie jedoch für kräftigen Rückenwind. Denn für identische Raten können sich Immobilienkäufer oder Bauherren heute entweder mehr an Kaufpreis leisten – oder aber eine höhere Tilgung vereinbaren.
In der obligatorischen Vergleichsrechnungen „Kaufen oder Mieten“ (zum Beispiel hier) schieben sich die Käufer wirtschaftlich nun weitaus schneller vor die Mieter als vorher, wie das folgende Beispiel zeigt: Eine dreiköpfige Familie bewohnt ein Haus zur Miete in einer Großstadt für 1500 Euro Kaltmiete. Sie interessiert sich für den Erwerb eines Hauses, welches inklusive Nebenkosten 450.000 Euro kosten würde. Bei unterstellen Instandhaltungskosten von zwei Prozent pro Jahr und jährlichen Zins- und Mietsteigerungen von ebenfalls zwei Prozent pro Jahr und einem Zinssatz für alternative Anlagen von angenommenen drei Prozent pro Jahr (etwa über einen Mix aus Aktien und Anleihen) sei das Budget der Familie für eine monatliche Rate exakt so hoch wie die Kaltmiete, also 1500 Euro pro Monat. Eigenkapital sei in Höhe von 20 Prozent der Gesamtkaufsumme vorhanden, also 90.000 Euro.
Noch vor zehn Jahren und den damals üblichen Bauzinsen von rund vier Prozent wäre damit lediglich eine Tilgungsleistung von einem Prozent möglich gewesen. Der Kauf hätte sich im Vergleich zur Miete gelohnt – ein wirtschaftlicher Vorteil hätte der Käufer im Vergleich zum Mieter jedoch erst nach 15 Jahren erzielt. Zu den heute geforderten Zinsen für Baugeld mit zehn Jahren Zinsbindung von gerade einmal noch 1,4 Prozent kann die Familie bei identischer Rate eine Tilgung von annähernd vier Prozent vereinbaren – damit hat sie bereits nach fünf Jahren einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der Miete und wäre bei gleichbleibenden Zinsen nach 24 Jahren schuldenfrei.
Riskante Finanzierungen sind die Ausnahme
Natürlich verführen die niedrigen Zinsen manche Bauherren auch zu waghalsigeren Finanzierungen – weil mit den identischen Raten auch höhere Kaufsummen darstellbar sind und manchmal sogar unumgänglich sind. Schließlich sind in den Metropolen die Kaufpreise zuletzt stark gestiegen. Allerdings sind riskante Modelle eine seltene Ausnahme: Insgesamt finanzieren deutsche Immobilienkäufer heute gemessen am eingesetzten Eigenkapital und der Länge der Zinsbindung nach übereinstimmenden Daten von Hypothekenmaklern wie Dr. Klein oder Interhyp, Abwicklungsplattformen für Immobilienkredite wie Europace und auch der Pfandbriefbanken heute konservativer als noch etwas vor fünf oder zehn Jahren. Auch die Anzahl der 100-Prozent-Finanzierungen sinkt im Vergleich zu früher. Zudem berichtet auch die Bundesbank von zuletzt eher strengeren denn laxeren Vergabe von Wohnimmobilienkrediten durch Banken und einem nur moderat steigenden Kreditvolumen insgesamt.
Der Bundesbank ist auch eine spannende Erkenntnis zu verdanken, die für die Frage des idealen Vermögensaufbaus von Bedeutung ist: In ihren laufenden Untersuchungen über die Finanzen der privaten Haushalte kam sie zu dem Schluss, dass Immobilienkäufer erheblich vermögender in Rente gehen als Mieter – und das selbst bei identischem Einkommen und wenn sie die Immobilie finanzieren. Und mehr noch: Immobilienkäufer haben selbst nach Abzug der Aufwendungen für Zins- und Tilgungsleistungen eine höhere Sparquote als Mieter. Die Gründe dafür sind zwar noch Gegenstand weiterer Untersuchungen.
In jedem Fall sind sich Verhaltensökonomen einig, dass ein Immobilienkredit stark disziplinierend wirkt: Viele Käufer und Bauherren arbeiten nach Kräften daran, einen Immobilienkredit aus Sicherheitsgründen so rasch wie möglich abzubezahlen, während Mieter den Vermögensaufbau auf anderen Wegen auf die lange Bank schieben oder sogar bestehende Reserven liquidieren können. Das zahlt sich auf lange Hand aus – erst recht beim aktuellen Zinsniveau.
Vier typische Fallen beim Immobilienerwerb
Wertentwicklung überschätzen – Die künftige Wertentwicklung ist der Dreh- und Angelpunkt der Wirtschaftlichkeitsrechnung „Kaufen oder Mieten“. In Städten sind die Preise angezogen, doch gerade Städte profitieren perspektivisch von einem starken Zuzug. Gerade in ländlichen Gebieten gilt: Lieber vorsichtig kalkulieren.
Zu wenig tilgen – Das niedrige Zinsniveau erlaubt Käufern größere Sprünge – kann jedoch die Rückzahlungsdauer verlängern, wenn Käufer kaum tilgen. Eine gute Zwischenlösung: Eine geringe Tilgung vereinbaren, sich aber hohe Sondertilgungsrechte einräumen lassen. Das lässt Spielraum je nach Einkommensstrom und Zinsentwicklung.
Nebenkosten unterschätzen – Der Immobilienerwerb ist oft eine Entscheidung für’s Leben. Entsprechend explodieren bei vielen Käufern und Bauherren die Kosten für Küche, Bodenbeläge, Fenster, Rolläden und Co., weil man zum Einzug nicht am falschen Ende sparen will. Daher bei den Kaufpreisen und Baukosten lieber gleich realistisch planen!
Zinstricks vergessen – Der Wettbewerb in der Immobilienfinanzierung ist hart, und viele Institute locken mit optisch niedrigen Darlehenszinsen. Entscheidend sind jedoch nicht die Angebote in anonymen Internetrechnern, sondern was die Bank konkret für eine Finanzierungszusage bietet. Bei geringem Eigenkapital oder ländlichen Immobilien entpuppen sich die in Aussicht gestellten Niedrigzinsen oft als Hoffnungswert. Vergleichen und verhandeln lohnt fast immer!