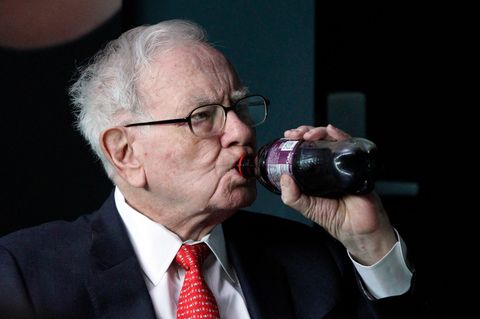Steven Andrew ist M&G-Multi-Asset-Fondsmanager. Er verwaltet den M&G Income Allocation Fonds
Capital: Mister Andrew, die Aktienmärkte korrigieren, die Zinsen haben in der Eurozone seit Mitte April einen der steilsten Anstiege der jüngeren Geschichte vollzogen, und das griechische Schuldendrama findet kein Ende. Muss man sich als Anleger sorgen machen vor diesem Belastungsmix?
Andrew: Wir erleben seit April fraglos volatile Zeiten, und inzwischen hat das Thema Griechenland auch den US-Kapitalmarkt erreicht – die Bewegungen der langfristigen Zinsen dort wird inzwischen auch gerne einmal mit den Nachrichten von den Verhandlungen mit den Griechen erklärt. Dabei wissen wir alle, dass das Blödsinn ist. Investoren lassen sich einfach zu gerne von einer einfachen Erklärung illusionieren, warum sich Aktien oder Zinsen in eine bestimmte Richtung bewegen. Derzeit ist es eben Griechenland, Ende 2012 war es die sogenannte fiskalische Klippe in den USA.
Die tatsächlichen Auswirkungen beider Probleme oder ihrer Lösungen auf die Wirtschaft und damit auch Unternehmensgewinne, Aktien und Anleihen in drei oder fünf Jahren sind überschaubar. In einer solchen Situation muss man einfach kühlen Kopf bewahren. Es gibt ein weit wichtigeres Thema.
…nämlich?
Wann wird die US-Notenbank die Zinsen anheben? Das mag abgedroschen klingen. Aber wir haben im Frühjahr 2013 bereits gesehen, zu welch raschen Verwerfungen es kommen kann, als seinerzeit die US-Notenbank lediglich den Ausstieg aus Lockerungen angekündigt hat. Dann muss man bedenken, dass die globale Verschuldung seit der Finanzkrise stark gestiegen ist. Das heißt, dass schon kleinere Zinsschritte große Auswirkungen haben – größere auf alle Fälle als noch vor der Finanzkrise.
Und, wohin steuern die US-Zinsen?
Ganz ehrlich: Wir haben keine Ahnung! Genauso wenig, wie wir wissen, welche Folgen ein „Grexit“ für den Euro oder „Brexit“ für das britische Pfund hätte. Wir treffen keine Prognosen für unseren Multi-Asset-Fonds „Income Alloaction“ und hoffen, dass sie aufgehen. Wir gleichen ab, wie der Großteil der Investoren positioniert ist, welche Erwartungen sie haben und wie wahrscheinlich es ist, dass das eingepreiste Szenario auch tatsächlich so eintritt. Also eher einen antizyklischen Ansatz, der sich die Verhaltensökonomik zunutze macht: Wir konzentrieren uns auf etwas, was wir schlicht nicht wissen, wovon andere aber fälschlicherweise glauben, dass sie es wissen. Wenn alle optimistisch für US-Aktien sind und die US-Konjunktur und die Bewertungen nicht günstig sind, dann ist es keine kluge Idee, US-Aktien zu kaufen.
wenig Raum für deutlich höhere Zinsen in Europa
Sie sind derzeit stark in Europa engagiert, sowohl mit Aktien als auch Anleihen. Wieso?
Bleiben wir bei den US-Zinsen: Wir meiden derzeit eher US-Staatsanleihen und den US-Dollar, weil wir glauben, dass die Mehrheit der Anleger nicht auf den Zinsschritt im Juni oder September vorbereitet ist und auch zu optimistisch für den Dollar ist. Umgekehrt erachten wir Europa tatsächlich für attraktiv. Viele Investoren sorgen sich um einen möglichen Grexit trotz günstiger fundamentaler Bewertungen und einer Wirtschaft, die in viel besserer Verfassung ist als vor zwei oder drei Jahren, als die griechischen Schulden schon einmal großes Thema waren.
Wieso sind europäische Staatsanleihen trotz deutlich niedrigerer Renditen für Sie attraktiver als ihre US-Pendants?
Wir sehen derzeit weder Gründe für einen deutlichen Anstieg der Inflation noch der Unsicherheit über die künftige Inflation oder gar der Leitzinsen. Damit fällt ein wichtiger Grund weg, der für höhere Renditen sorgen könnte. Wenn dann die Renditen wegen kurzfristiger Ereignisse nach oben schießen wie etwa jüngst in der Griechenland-Debatte italienische Staatsanleihen, die wieder kurzzeitig 3,3 Prozent pro Jahr abwarfen, dann kaufen wir zu. Wir sehen wenig Raum für deutlich höhere Zinsen in Europa, weder fundamental noch gemessen an der Stimmung und Positionierung der Investoren. Genau solche von kurzfristigen Debatten getriebene Kursdifferenzen wollen wir nutzen.
Kurzfristige Debatten? Solche Argumente gab es auch 2007 schon zu hören – heute heißt es, Griechenland entspreche nur zwei Prozent der Wirtschaftsleistung Europas, damals waren Subprime-Kredite nur ein kleiner Prozentsatz aller Verbriefungen. Trotzdem gab es eine Kettenreaktion.
Es gibt einen entscheidenden Unterschied: Heute gehören Nullzinsen und Anleihenaufkäufe ganz selbstverständlich zum Werkzeugkasten der Notenbanken, etwas, was man seinerzeit für ausgeschlossen hielt. Auch die These, dass drastische Anleihenaufkäufe und Nullzinsen ultimativ zu Hyperinflation und Währungschaos führten, ist nicht haltbar nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Nun kann man argumentieren, dass damit auch schon viel Pulver verschossen wurde, um einem Abschwung zu begegnen.
Aber die Gefahr eines Überschwappens der Krise oder Liquiditätsschocks ist heute kleiner als damals. Nehmen Sie doch alleine Mario Draghis klares Bekenntnis, als letzte Instanz den Euro zu schützen aus dem Sommer 2012: Damals haben die Akteure an den Kapitalmärkten Draghi nicht einmal herausgefordert, es zu beweisen. Die Worte haben gewirkt ohne einen Cent Einsatz. Nun ist Glaube nichts, worauf wir unsere Anlageentscheidungen stützen, aber es zeigt, wie sich die Wahrnehmung der Notenbanken verändert hat.