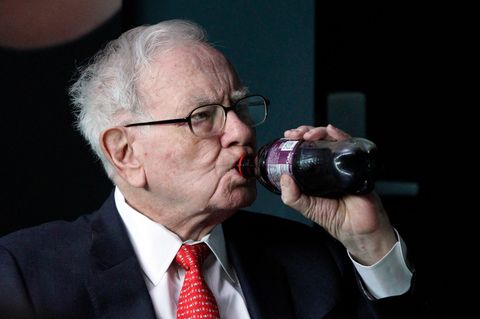Christian Kirchner ist Frankfurt-Korrespondent von Capital. Er schreibt an dieser Stelle regelmäßig über Geldanlagethemen. Hier können Sie ihm auf Twitter folgen
Analysten und Journalisten auf der einen und ihre Kunden und Leser auf der anderen Seite haben seit jeher eine symbiotische Beziehung. Jeden Tag passiert am Ende das gleiche: Aktien steigen oder fallen, Zinsen steigen oder fallen – aber es müssen laufend frische, kurzfristige und vor allem neue Erklärungen her, warum denn was passiert ist. Schließlich will niemand langweilen und Empfänger hätten gerne Neuigkeiten.
Gut abzulesen ist das an der Entwicklung der vergangenen Tage: Als wichtigste Begründung für den Rutsch der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen unter null Prozent gilt die „Verunsicherung“ über den drohenden „Brexit“ nach dem Referendum in Großbritannien am 23. Juni.
Solche kurzfristigen Erklärungen sind ebenso gefährlich wie trügerisch. Gefährlich sind sie, weil sie zu falschen Schlüssen führen. Wenn es stimmt, dass die „Brexit“-Sorgen das britische Pfund, die Aktienmärkte und die Renditen von Bundesanleihen unter Druck setzen, heißt das umgekehrt noch lange nicht, dass Aktien, Pfund und Zinsen wieder klettern, wenn die Briten für einen Verbleib in der Europäischen Union stimmen. Aber auch nicht, dass uns nach einem „Brexit“ der Crash droht. Schließlich gibt es nicht die eine Begründung für eine Entwicklung und niemand kann mit Bestimmtheit sagen, ob und wie viele Dominosteine in Europa oder an den Märkten umfallen, je nach dem wie die Abstimmung ausgeht.
Gründe sind nicht völlig neu
Trügerisch ist die „Brexit“-Erklärung, weil die Gründe für den Rutsch der langfristigen Zinsen unter null Prozent in Deutschland tiefer liegen – aber eben auch nicht völlig neu sind und gerne vergessen werden. Gehen wir die wichtigsten durch:
• Die Tatsache, dass der Bund als Schuldner das Angebot an Anleihen aufgrund der Haushaltsdisziplin laufend verknappt. Alleine im April schrumpfte das Volumen ausstehender Bundesanleihen um den Nennwert von rund 13 Mrd. Euro, weil der Bund mehr Anleihen zurückgezahlt als neue ausgegeben hat.
• In diesem schrumpfenden Markt ist mit der Europäischen Zentralbank seit Frühjahr 2015 ein mächtiger Aufkäufer unterwegs, der inzwischen rund 180 Mrd. Euro an Bundesanleihen erworben hat und die Bandbreite und das Volumen seiner Aufkäufe seitdem ausweitet
• Viele Käufer von Bundesanleihen zu Renditen unter null Prozent sind nicht unbedingt risikoavers, sondern handeln schlicht rational. Das gilt beispielsweise für Versicherungen, die aufsichtsrechtliche Kapitalquoten zu erfüllen haben. Für sie sind langlaufende Bundesanleihen bei der Berechnung ihrer Kapitalstärke meist wertvoller als Bargeld (und umgekehrt verschlechtert ein Verkauf von Bundesanleihen und der Tausch in Cash die Kapitalquote womöglich – auch wenn das sinnvoll erscheinen mag).
• Vielen Großanlegern ist das Renditeniveau herzlich egal. Das gilt etwa für jene Pensionskassen oder Versorgungswerke, die heute schon recht genau wissen, welche Zahlungen sie in zehn oder 15 Jahren mit den heute eingezahlten Mitteln leisten müssen. Wenn sie es aufgrund der Struktur der Beitragszahler auch mit renditefreien Bundesanleihen schaffen, halten sie an den Papieren einfach fest oder kaufen zu. Beschimpfen sie dafür nicht diejenigen, die so handeln, sondern jene, die sich die Privilegierung von Staatsanleihen in der Post-Lehman-Ära ausgedacht haben: Politiker, Notenbanker und Regulierer.
• Die Niedrigzinsen und Anleihenaufkäufe der Europäischen Zentralbank haben ein explizites Ziel: Die Inflationserwartungen wieder anzuheben. Die steigen aber nicht, sondern fallen, seit Beginn der Anleihenaufkäufe um rund 0,4 Prozentpunkte auf zuletzt noch 1,35 Prozent pro Jahr für künftige Inflation in fünf Jahren. Je geringer die Inflationserwartungen, desto geringer auch der Druck potenzieller Anleihenaufkäufer, für eine künftige Inflation über höhere Zinsen kompensiert werden zu wollen.
Neue Gründe für die Entwicklung gibt es nicht
Die Realität kann manchmal furchtbar langweilig sein, denn wirklich neue Gründe für eine intuitiv nur schwer fassbare Entwicklung gibt es nicht: Politik, Regulierungsbehörden und Notenbanken sind einen Pakt eingegangen, in denen niedrige Zinsen das zentrale Element sind um die Wirtschaft anzukurbeln und den Druck von den Staatshaushalten zu nehmen.
Dass die Realität furchtbar langweilig sein kann, gilt allerdings auch für die Risiken, die dieser Pakt mit sich bringt: Für Banken, deren Zinsmargen unter Druck geraten. Ablesbar ist das etwa an den Kursen von Bankaktien wie der Deutschen Bank oder der Commerzbank, die inzwischen wieder ihre Mehrjahrestiefs aus dem Februar erreicht haben. Aber auch für die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften generell, wo die Monstrosität der Fehlallokationen aufgrund von Null- und Negativzinsen permanent steigt.
Dass die Realität furchtbar langweilig sein kann, gilt auch für Sparer. Die haben – glaubt man den Bundesbank-Studien und nicht den von PR-Abteilungen der Finanzdienstleister beauftragten Umfragen – erstaunlicherweise in Deutschland ihr Spar- und Vorsorgeverhalten in den vergangenen fünf Jahren nur unwesentlich verändert, obwohl die rekordtiefen Zinsen eigentlich dafür sprächen, den Anteil realer Vermögenswerte wie Aktien, Immobilien und Edelmetalle zu erhöhen.
Vermutlich müssen wir Journalisten uns dabei aber auch an die eigene Nase fassen: Wer, wie wir so oft, ständig tagesaktuellen Bewegungen nachhechelt und einfachen Anlässen hantiert, muss sich nicht wundern, wenn der Kapitalmarkt in Deutschland von vielen nicht als ein Ort des Risikotransfers und der rentablen Geldanlage wahrgenommen wird, sondern schlicht als Casino.
Newsletter: „Capital- Die Woche“
Jeden Freitag lassen wir in unserem Newsletter „Capital – Die Woche“ für Sie die letzten sieben Tage aus Capital-Sicht Revue passieren. Sie finden in unserem Newsletter ausgewählte Kolumnen, Geldanlagetipps und Artikel von unserer Webseite, die wir für Sie zusammenstellen. „Capital – Die Woche“ können Sie hier bestellen: