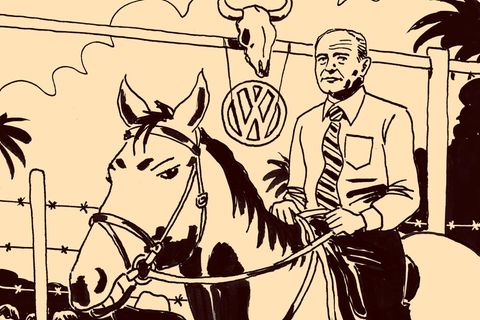Ohne spürbare Resonanz an den Kapitalmärkten setzt sich die Serie der enttäuschenden Konjunkturdaten aus dem Land der aufgehenden Sonne fort. Japans Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 6,8 Prozent so stark wie seit der Tsunami-Katastrophe 2011 nicht mehr. Die Uneinigkeit unter den Japanexperten erhält damit weitere Nahrung, da die Reformen der seit 2012 amtierenden Administration eher zu gegenteiligen Entwicklungen führen sollten. Während die einen von einer kraftvollen Rückkehr der bis zum Ende der 80er-Jahre so mächtigen Industrienation in den Kreis der Lokomotiven der Weltwirtschaft träumen sehen andere nur ein Strohfeuer, dessen Flammen durch eine drastische Verbilligung der Währung gespeist werden.
Längst vorbei sind die Zeiten, in denen die südeuropäischen Krisenländer sehnsüchtig auf die Anfangserfolge der Abenomics geschaut haben. Der Begriff steht für die aktuelle japanische Wirtschaftspolitik mit dem Ziel der Reflationierung, benannt nach dem seit 2012 regierenden Ministerpräsidenten Shonzo Abe. Heute sprechen japanische Quellen bereits abfällig über ein „Abegeddon“ (in Anlehnung an einen Weltuntergangsstreifen aus Hollywood), um nur eine der Verballhornungen zu nennen.
Der dritte Pfeil blieb im Köcher
In Anlehnung an alte shintoistische Mythen versprach die neue Regierung nach ihrer Wahl im Jahr 2012 metaphorisch den Abschuss von drei Pfeilen. Zwei davon wurden tatsächlich zum Fliegen gebracht und kamen wie gewünscht ins Ziel. Zunächst wurde mit einer ultralockeren Geldpolitik die heimische Währung drastisch abgewertet. Dies führte in vergleichsweise kurzer Zeit zu einer Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit japanischer Unternehmen und kurzzeitig auch zu einem beachtlichen Wirtschaftswachstum. Mit dem zweiten Pfeil erreichte die Administration eine expansivere Fiskalpolitik. Beides zusammen führte auch zu einem Ende der jahrelang lähmenden Deflation.
Nur der dritte Pfeil, der aus unserer Sicht für den langfristigen Erfolg der Reformen die größte Bedeutung hat, blieb bislang im Köcher. Die Rede ist von den längst überfälligen Strukturreformen, die Japan nicht nur wirtschaftlich zukunftsfähig machen sollen. Das Vertrauen in ein Gelingen der aktuellen wirtschaftspolitischen Wende ist bei den Japanern selbst nur sehr gering ausgeprägt. Sie investieren wenig und horten in Dimensionen Bargeld. So hat sich die Summe der im Umlauf befindlichen Banknoten seit Mitte der 90er-Jahre mehr als verdoppelt. Etwa ein Drittel der Bevölkerung verfügt über keinerlei Kapitalanlagen. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftsexpansion 1989 betrug die Abstinenz vom Kapitalmarkt lediglich fünf Prozent.
Es sind jedoch nicht nur die privaten Haushalte denen das Vertrauen fehlt, ein ähnliches Verhalten stellen wir bei einer vergleichenden Untersuchung des Cash-Managements der Firmen fest. Deren Barreserven in Höhe von umgerechnet rund 500 Mrd. Euro liegen heute deutlich höher als vor dem Beginn der sogenannten Abenomics. In einem deflationären Umfeld war dies angesichts der risikofreien Zunahme des Vermögens sinnvoll und plausibel. Nach der ersehnten Rückkehr der Inflation verliert diese Strategie jedoch sukzessive ihre Basis.
verheerende demographischen Entwicklung
Neben der erwähnten Entwicklung der Preise kann die Administration auch eine deutliche Belebung der Industrieproduktion und eine klare Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Unternehmen auf der Habenseite verbuchen. Insbesondere die Gewinne der exportorientierten Firmen sind beträchtlich gestiegen und der Arbeitsmarkt hat sich weiter erholt. Leider kann die Lohnentwicklung mit den erheblichen Preissteigerungen nicht mehr Schritt halten und die jüngste Mehrwertsteuererhöhung belastet die Konsumenten zusätzlich. Die geringe Arbeitslosenquote sollte auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass feste Verträge mit guten Gehältern inzwischen in Japan Seltenheitswert haben. Die Armutsquote Japans, gemessen nach OECD Standards, ist die sechsthöchste von allen 34 OECD-Staaten. Viele Beobachter erklären die scheinbar günstige Lage am Arbeitsmarkt auch mit der verheerenden demographischen Entwicklung.
Japans Staatsschulden liegen mit etwa 240 Prozent der Wirtschaftsleistung weit höher als bei Europas Sorgenkindern. Die Schuldenlast kann derzeit angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen vergleichsweise gut bewältigt werden, wenn auch der Staatshaushalt trotz rekordtiefer Zinsen zur Hälfte für den Schuldendienst gebraucht wird. Mehr als 95 Prozent der Staatsschulden werden von den Japanern selbst finanziert und die Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern ist traditionell noch immer gering. Darüber hinaus verfügen Unternehmen und Haushalte über enorme Rücklagen und der Staat über ein anschauliches Auslandsvermögen.
Das wird sich vor dem Hintergrund der absehbaren demographischen Verwerfungen jedoch in Kürze ändern. Ein wachsender Anteil der Bevölkerung fällt künftig als Sparer entweder wegen fehlender Spielräume aus oder wird als Rentner eher entsparen. Der Anteil der über 65-jährigen wächst voraussichtlich von heute 24 Prozent auf über 40 Prozent in den nächsten 50 Jahren. Wirtschaftspolitisch spürbar wird diese Entwicklung auch anhand der jüngsten Steuerveränderungen schon heute. Inzwischen ist es lukrativer den Verbrauch anstatt der Einkommen zu besteuern.
Unser Optimismus bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung Japans hält sich angesichts dieser Gemengelage in Grenzen. Nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben frustrierte Investoren Japan zu dem Ort erklärt, an dem sich „das Kapital zum Sterben niederlegt“. Der Gegenbeweis ist noch zu erbringen. Die Sonne stört das wenig, sie geht nach wie vor im Osten auf.