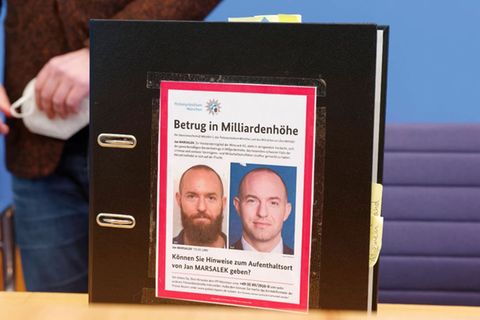Sportwettenanbieter und Fußball sind mittlerweile untrennbar verbunden – ihre Werbung läuft in der Halbzeitpause, ziert Trikots und ist auf allen Werbebanden im Stadion präsent. Auch während der Fußball-Europameisterschaft kommt niemand an den omnipräsenten Anbietern von Sportwetten vorbei. Laut dem Deutschen Sportwettenverband (DSWV) sei die EM für die Branche „das wichtigste Ereignis des Jahres“. Die massive Werbung soll Spielwillige laut dem DSWV zu legalen Angeboten leiten – Werbung ist nämlich nur lizenzierten Anbietern erlaubt. Dem steht ein riesiger Schwarzmarkt gegenüber: Ein Drittel der Wetteinsätze in Deutschland gehe an illegale Anbieter, schätzt der DSWV.
Anbieter unerlaubter Online-Sportwetten landen aktuell vielfach vor Gericht: Spieler, die in den vergangenen Jahren bei ihnen mitunter Tausende Euro verzockt haben, fordern ihre Verluste zurück. Oft müssen sich dabei etablierte Wettanbieter wie Bwin oder Tipico verantworten. Denn auch ihnen fehlte lange Zeit eine Erlaubnis, Sportwetten in Deutschland anzubieten. Nun verhandelt der Bundesgerichtshof am Donnerstag einen Fall, in dem sich ein Spieler mit dem Anbieter Tipico streitet (Az. I ZR 90/23). Gut sieht es für Tipico nicht aus – in einem anderen Verfahren hatte sich der Bundesgerichtshof (BGH) schon deutlich auf die Seite der Spieler gestellt, auch wenn es damals nicht zu einem Urteil kam.
Online-Sportwetten erst seit 2021 erlaubt
Bei dieser Europameisterschaft hat es erstmals ein Wettanbieter in die Reihe der Hauptsponsoren geschafft: Betano steht beim DSWV auf der Liste der lizenzierten Anbieter, der sogenannten Whitelist. Das war aber nicht immer so. Denn vollständig erlaubt und reguliert sind Online-Sportwetten hierzulande erst seit 2021.
In den Jahren zuvor agierten Online-Wettanbieter in einer rechtlichen Grauzone: Obwohl sie Konzessionen für die Veranstaltung von Onlinesportwetten beantragt hatten, gaben die zuständigen deutschen Bundesländer keine aus – wegen Änderungen in den Glücksspielstaatsverträgen bestanden rechtliche Unklarheiten. Als Lösung beriefen sich die Anbieter auf ausländische Lizenzen etwa aus Malta oder Gibraltar. Allerdings blieb unklar, ob die Zulassungen durch EU-Recht auch in Deutschland gelten.
Erstes BGH-Verfahren scheitert an Betano-Rückzug
Das veranlasste einen Spieler, der 2018 fast 12.000 Euro verwettet hatte, seine Verluste zurückzuverlangen. Der Streit mit dem Anbieter erreichte den Bundesgerichtshof (Az. I ZR 88/23). Zur Vorbereitung auf die Verhandlung schätzten die Richterinnen und Richter des ersten Zivilsenats die Rechtslage vorläufig ein und rechnete dem Wettanbieter schlechte Chancen aus, das Verfahren zu gewinnen: Er habe gegen Regelungen des Glücksspielstaatsvertrags in seiner Fassung von 2012 verstoßen.
Da Betano also verbotene Wetten angeboten habe, dürfte der Vertrag mit dem Spieler nichtig sein und der Kläger einen Rückzahlungsanspruch haben, so das Gericht. Zu einem endgültigen Urteil kam es allerdings nicht, da Betano die Revision kurz vor der mündlichen Verhandlung zurückzog. Stattdessen akzeptierte das Unternehmen seine Niederlage, die es schon beim vorinstanzlichen Oberlandesgericht kassiert hatte, und zahlte dem Kläger seine Verluste zurück.
Tipico: Kommt es diesmal zum Grundsatzurteil?
Nun steht ein weiterer Sportwettenanbieter vor dem BGH (Az. I ZR 90/23): Der Prozessfinanzierer Gamesright übernimmt für einen glücklosen Tippspieler und klagt gegen das Unternehmen Tipico. Das warb jahrelang mit der Ex-Startorwart Oliver Kahn und dem Werbespruch „Ihre Wette in sicheren Händen“.
Im Verfahren geht es um Verluste in Höhe von 3719,26 Euro, die der Spieler in den Jahren 2013 bis 2018 verbuchte. In diesem Zeitraum verfügte Tipico zwar über eine Lizenz der maltesischen Glücksspielaufsichtsbehörde, aber nicht über eine deutsche Erlaubnis zur Veranstaltung von Sportwetten. Diese erteilte die zuständige Behörde erst im Oktober 2021.
Nachdem Vergleichsverhandlungen im April gescheitert waren, könnte es im Tipico-Fall nun zu einem Grundsatzurteil kommen, ob Spieler bei illegalen Sportwetten verlorenes Geld zurückfordern können. Das Ergebnis könnte zahlreiche Spieler interessieren, die in den vergangenen Jahren Wetteinsätze verloren haben. Bleibt der BGH seiner Linie treu und fällt ein Urteil im Sinne der Wettverlierer, könnte gar eine Klagewelle folgen.
Zumindest, wenn der BGH die zehnjährige Verjährungsfrist für Rückforderungen aus Sportwetten bestätigt, von der die meisten Oberlandesgerichte bisher ausgehen. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist für Forderungen nämlich lediglich drei Jahre.