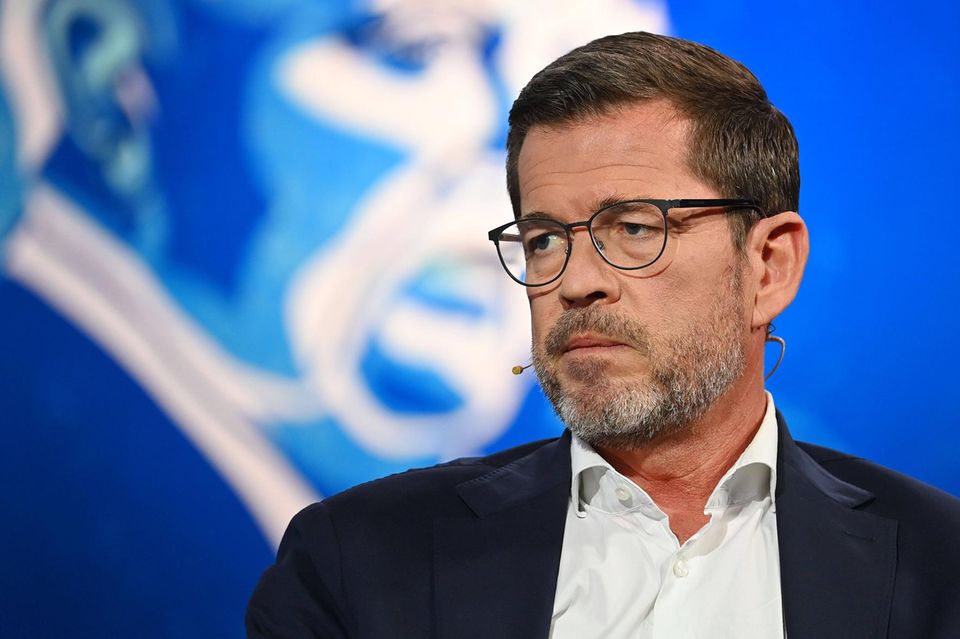Der individuelle CO2-Fußabdruck gehört zu den vielleicht genialsten Erfindungen politischer PR. Populär gemacht hat ihn nicht etwa Greenpeace, sondern ein Ölkonzern. Denn die implizite Botschaft ist bequem für die großen fossilen Unternehmen der Welt: Die Verantwortung dafür, dass unser wirtschaftliches Streben unseren Planeten nicht zerstört, wird auf das Individuum abgewälzt.
Auch die Befürworter des Degrowth in der Klimadebatte sind den Konzernen letztlich – ohne es zu wollen – dienlich. Fakt ist: Mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung fängt mit dem Konsum gerade erst richtig an – laut UN-Prognosen werden bis 2040 rund 60 Prozent der Konsumentinnen, die mehr als 32 Dollar am Tag verdienen, außerhalb des Westens leben. Dort wird sich niemand vom satten Westen, der seit Jahrzehnten im Überfluss lebt, sagen lassen, dem Klima zuliebe auf die Waschmaschine oder die Zwei-Zimmer-Wohnung zu verzichten.
Weniger heizen, weniger fliegen, weniger konsumieren – das alles wird global nicht funktionieren. Wer die Weltrettung allein zur Sache des Individuums macht, wird scheitern. Die Systeme, in denen die Individuen ihre Entscheidungen treffen, werden von anderen gebaut, insbesondere von Staaten und Unternehmen. Erst, wenn diese Systeme nachhaltiges Handeln einfacher machen, werden die Menschen dies auch tun.
Nachhaltig sollte Standard sein
Die gute Nachricht: Möglich ist das schon lange. Dafür müssen Unternehmen allerdings ihrer Verantwortung nachkommen und ihre Produkte ökologisch und sozial nachhaltig anbieten. Erzeugt mit Energie aus erneuerbaren Quellen und aus ökologisch und sozial korrekt gesourceten Rohstoffen aus einer Lieferkette mit ethischen Standards. Dies ist heute alles keine Science Fiction mehr.
Konsumenten sollten im besten Fall gar keine Wahl haben, Fairtrade- und Öko-Label wären überflüssig. Wer im Supermarkt zu einem beliebigen Produkt greift, sollte einen nachhaltigen Artikel kaufen – ganz automatisch, ohne nachzudenken. So wie sich heute auch niemand Gedanken machen muss, ob ein bestimmtes Produkt grundlegende Hygiene-Standards erfüllt.
Dafür müssen vor allem Unternehmen umdenken. Denn bislang sind in der Wirtschaft vor allem zwei Strategien zu beobachten: Abwälzen der Verantwortung auf die Konsumenten oder gnadenloses Green- und Socialwashing. Wir müssen uns keine Sorgen um unseren To-go-Kaffee machen, weil aus dem Pappbecher anschließend ein Buch werden kann? Unabhängig davon, ob aus dem generell sehr schwer recycelbaren Verbundstoff wirklich ein Buch werden kann: die bessere Lösung wären wiederverwendbare Gläser.
Tun wir nichts, wird uns die Politik zwingen
Stattdessen sollten Unternehmen ökologisch und sozial nachhaltiges Handeln zu einem Kernmerkmal ihrer Produkte machen – ein USP, der Kundinnen dazu bewegt, genau dieses Produkt zu kaufen. Statt Gutes zu tun, um darüber zu kommunizieren, muss der soziale und ökologische Impact fest im betriebswirtschaftlichen System der Firma verankert werden.
Wir brauchen einen Kapitalismus, der mit unseren Lebensgrundlagen kompatibel ist. Wir als Unternehmer haben letztlich auch keine andere Wahl: Entweder arbeiten wir aktiv daran mit, die großen ökologischen und sozialen Herausforderungen zu bewältigen – oder die Politik wird uns früher oder später über Regulierung dazu zwingen, mit allen negativen Folgen für unsere unternehmerische Freiheit und damit letztendlich auch für künftige Innovationen. In einem solchen grünen und sozialen Kapitalismus darf dann auch gerne viel Geld verdient werden.
Wenn wir Unternehmerinnen den Erhalt des Planeten und unsere soziale Verantwortung als Grundlage unserer wirtschaftlichen Freiheit begreifen und endlich Verantwortung dafür übernehmen, ist das eindeutig der bessere Weg.