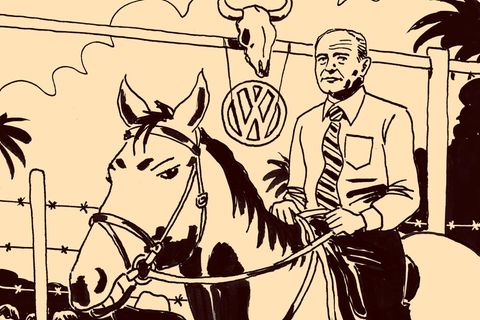Matthias Thiel ist Ökonom bei der Privatbank M.M. Warburg
In der Öffentlichkeit wird bereits seit längerem eine leidenschaftliche Debatte über die Auswirkungen von Staatsausgaben auf das Wirtschaftswachstum geführt. Wir halten diesen öffentlichen Diskurs für sehr wichtig, schließlich berührt die Frage nach mehr oder weniger Staatsausgaben einige wirtschaftlich und sozial höchst bedeutsame Punkte: Wie wird der Wohlstand zwischen der heutigen und zukünftigen Generation verteilt? Welche Verteilungswirkung erzielen die Staatsausgaben? Und letztlich: Inwieweit erhöht eine nochmalige Ausweitung der Staatstätigkeit die makroökonomischen Risiken?
Ausgangspunkt der Diskussion: In vielen Ländern wurde die Ausweitung der Staatstätigkeit über Jahrzehnte größtenteils über neue Schulden finanziert. Die Folgen sind heute kaum mehr zu übersehen. So befinden sich die öffentlichen Haushalte in einem desolaten Zustand und werden mitunter – wie in Japan – direkt von der Notenbank finanziert.
Viele Ökonomen vertreten daher die Meinung, dass die Ausweitung der öffentlichen Verschuldung zumindest gebremst werden muss. Uneinigkeit besteht jedoch in der Frage, wie dies gelingen kann. Denn es besteht ein kaum lösbarer Zielkonflikt zwischen der öffentlichen Haushaltskonsolidierung und dem Wirtschaftswachstum: Mehr sparen führt zunächst fast immer zu weniger Wachstum.
Höhere Staatsausgaben helfen nur kurzfristig
Erschwerend für die Politik ist der Umstand, dass ein tragfähiges Verschuldungsniveau nur erreicht werden kann, wenn zumindest für eine sehr lange Zeit Maß bei den öffentlichen Ausgaben gehalten wird. Die Verwerfungen, die mit dieser Politik einhergehen, können durch flankierende Maßnahmen – wie einer extrem expansiven Geldpolitik, selektiven Investitionsmaßnahmen und Strukturreformen – lediglich abgeschwächt, aber nicht vollständig abgefedert werden. Es kann daher auch nicht verwundern, dass zumindest das Ausmaß der Sparmaßnahmen in der Öffentlichkeit hoch umstritten ist.
Bisweilen könnte man gar den Eindruck gewinnen, dass gerade US-amerikanische Ökonomen bzw. Politiker die Position vertreten, die Lösung des Schuldenproblems läge darin, dass Staaten noch mehr Geld ausgeben und noch mehr Schulden machen. Dies würde die Wirtschaftsleistung erhöhen und der betroffene Staat würde gewissermaßen aus dem Schuldenproblem herauswachsen. Doch diese Empfehlung hält einer eingehenden Betrachtung nur höchst eingeschränkt stand.
Denn kurzfristig kann eine Erhöhung der Staatsausgaben die Konjunktur zwar stützen, langfristig führen eine Ausweitung der Staatstätigkeit sowie eine höhere Staatsverschuldung zu einem geringeren Wachstum. Wir haben für verschiedene Länder Berechnungen angestellt, in welchem Zusammenhang der Wohlstandszuwachs (gemessen am Wachstum des Pro-Kopf-BIPs) und die Staatsausgaben stehen. Das Ergebnis: Jeder Prozentpunkt Staatsausgaben mehr geht mit einem um rund 0,05 Prozentpunkte geringeren Pro-Kopf-BIP-Wachstum einher.
Auch theoretisch macht dieses Ergebnis Sinn: Ein Staat mit hohen Ausgaben greift in der Tendenz stärker in das Wirtschaftsgeschehen ein. Außerdem liegt das Produktivitätswachstum im öffentlichen Sektor niedriger als im privaten Sektor.
Politikmix mit mittel- bis langfristigen Chancen
Zudem deuten unsere Berechnungen darauf hin, dass es auch einen negativen Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-Wachstum und der öffentlichen Verschuldung gibt. Heiß diskutiert wurde in diesem Zusammenhang eine Studie von Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff aus dem Jahr 2010. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass Länder ab einer Verschuldung von 90 Prozent gemessen am BIP langsamer wachsen. Später stellte sich heraus, dass dieses Ergebnis auf einem Berechnungsfehler beruhte. Untergegangen in der Diskussion über die 90-Prozent-Grenze ist aus unserer Sicht jedoch, dass es durchaus gute Gründe dafür gibt, die Verschuldung nicht immer weiter ansteigen zu lassen. Und einer davon scheint zu sein, dass eine hohe Verschuldung das Pro-Kopf-Wachstum langfristig eben doch etwas drückt.
Wir plädieren daher für einen Politikmix, der mittel- bis langfristig Erfolgsaussichten hat. Dieser muss berücksichtigen, dass nur Sparmaßnahmen alleine ungenügend sind, um die öffentliche Verschuldung kräftig zu senken; eine rigorose Sparpolitik über einen Zeitraum von einer bis zwei Dekaden ist in demokratischen Systemen kaum durchsetzbar. Wir sprechen uns daher dafür aus, dass die Sparmaßnahmen von einer extrem expansiven Geldpolitik und selektiven Investitionen flankiert werden. Strukturreformen müssen durchgesetzt werden, um das mittelfristige Wachstumspotenzial zu erhöhen.
Vor diesem Hintergrund halten wir es für bedauerlich, dass sich die Debatte um Staatsausgaben und Sparmaßnahmen regelmäßig nur um einzelne Aspekte dreht, die zur Glaubensfrage hochstilisiert werden: Sollen die Staaten mehr Geld ausgegeben oder weniger, muss die EZB mehr machen oder weniger, sind mehr Reformen notwendig oder weniger, wie hilfreich sind Investitionen? Wir halten es für sicher, dass nur ein umfassendes und langfristig angelegtes Maßnahmenbündel zu mehr Wachstum und weniger Schulden führen kann.