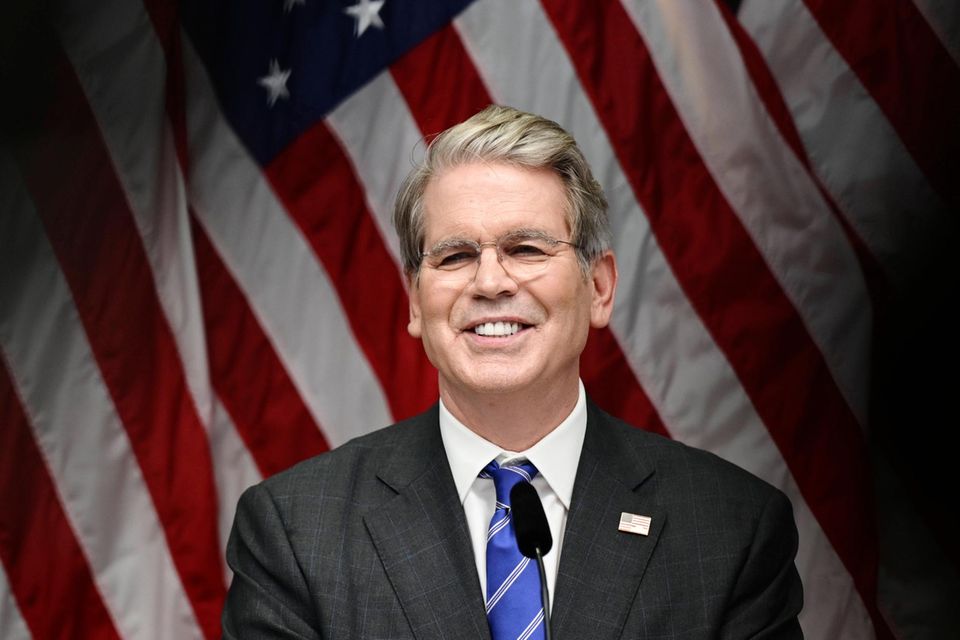Ich habe einen Bekannten, den ich echt schätze. Er beschäftigt sich bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit digitalem Risikomanagement und warnt mich regelmäßig: „Passt bloß auf, dass euch das in Schweden nicht so was von auf die Füße fällt, Maike.“ Plus des Zusatzes: „Halte dich als öffentliche Person bloß aus der fachlichen Diskussion raus.“ Auch das könne nach hinten losgehen.
Ich werde mich also nicht dazu hinreißen lassen, eine Diskussion darüber anzufachen, welcher Weg richtig oder falsch ist. Das können wir erst sagen, wenn die Krise wirklich vorbei ist. Ich möchte erklären, warum der schwedische Sonderweg nur aus Schweden kommen kann und was er mit dem nordischen Führungsstil zu tun hat.
Eins vorab: Schweden lieben ihre Großmütter genauso, wie wir. Und sie lieben ihre Freiheit. Die lieben sie über alles. Alle Schweden lieben sie. Und verteidigen sie gerne. Auch die Großmütter tun dies. Denn sie haben sich ihre Freiheit mit Verantwortung hart erarbeitet.
„Sorry, aber hier könnt ihr leider nicht sitzen. Möchtet ihr euch hierhin setzen, wegen des Abstandes?“, so Enrico, der Besitzer der kleinen Weinkellerbar, schräg gegenüber meiner Wohnung. Die Straßen sind hier leer, an den Kassen hängen Plexiglasscheiben, von den Tausenden Fahrgästen, die in Stockholm sonst täglich 1,2 Millionen mal die Metro nutzen, fehlt bis auf wenige jede Spur. Im größten Einkaufszentrum Skandinaviens treffe ich nur auf circa 20 Leute, einige Geschäfte scheinen bereits pleite gegangen zu sein. Die Wirtschaft stöhnt, aber es läuft zuckelnd weiter. Irgendwie.
Schwedische Bescheidenheit
Sie machen hier einfach ihr Ding. Denn wie es Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell erklärt: „Was hier in Schweden funktioniert, muss nicht in anderen Ländern funktionieren.“ Das so zu sehen ist ziemlich schwedisch, denn Schweden ist das individualistischste Land der Welt . Sie sind es gewohnt Einzigartigkeit und die damit verbundenen Unterschiede in Ansichten und Herangehensweisen auszuhalten.
Sie stellen deshalb prinzipiell erst einmal alles infrage. Warum so tun, wie es andere tun? Der deutsche Weg kann für Deutschland der einzig Richtige sein. Der italienische in Italien zwingend notwendig. Doch ist er es auch für Schweden? Haben wir enge Familienbande und diese Körperlichkeit der Italiener? Haben wir ein Gesundheitssystem auf dem gleichen Niveau? Die gleiche Bevölkerungsdichte? Sind wir gleichermaßen digitalisiert wie Deutschland? Haben Deutsche und Schweden dieselbe Mentalität? Nicht zuletzt: Teilen wir dieselben Annahmen?
Andere Voraussetzungen erfordern andere Maßnahmen
„Lagom“ – Maßnahmen, wie es die Schweden nennen würden: nicht zu viel, nicht zu wenig, gerade richtig. Und deshalb gehen die Kinder immer noch in die Kitas und bis zur 10. Klasse in die Schule, weil Schweden nun einmal in puncto Gleichberechtigung weltweit führend ist. Das bedeutet, dass beide Eltern meist 100 Prozent arbeiten. Könnten die nicht mehr zur Arbeit gehen, wäre die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet. Und auch die Chancengleichheit der Kinder nicht mehr. Maßnahmen werden aber auch hier getroffen. Nach eigenem Ermessen, nicht nach dem der anderen. Auch, wenn die anderen der Rest der Welt sind.
David, ein englischer Journalist und ich, planen einen Artikel über Schweden zu schreiben. Er hat, genauso wie ich über Skandinavien, ein sehr lesenswertes Buch über Schweden veröffentlicht . Heute schreibt er mir über Linkedin: „Nun scheint der Moment gekommen zu sein, das Bild über Schweden in der Wahrnehmung der internationalen Presse der Realität anzupassen. Schweden sollte nicht mehr als „sozialistisches“ Land mit einem allmächtigen Staat gesehen werden, sondern als liberale Gesellschaft, in welcher von den Bürgern erwartet wird, sich verantwortlich zu verhalten.“
Freiheit, Vertrauen und Verantwortung ist die Grundlage des schwedischen Sonderweges. Die schwedische Regierung vertraut darauf, dass ihre Bürger jetzt die Mittel anwenden, die sie schon in der Schule gelernt haben: selbstständig denken, zum eigenen Besten und zum Besten aller. Schule und Erziehung dient nicht nur der puren Wissensvermittlung oder der Vermittlung von Verhaltensregeln.
Schule ist im Norden ein Ort der Persönlichkeitsbildung durch Wissen. Sie dient ausdrücklich der Demokratieformung. Sie lehrt ihre Schüler, mündig zu sein und Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft zu übernehmen. Und das ist verknüpft mit einem tiefen Sinn-Empfinden, selbstwirksam und bedeutungsvoll zu sein. Das ist wohl einer der Gründe, weshalb Schweden zu den glücklichsten Menschen der Welt gehören.
Wer keine Verantwortung übernimmt, kann niemals Freiheit erlangen
Und deshalb üben sich die kleinen Pippis, Tommys und Anikas schon früh darin, für ihr Tun auch die passende Verantwortung zu übernehmen. „Frihet under ansvar“ (Freiheit unter Verantwortung), so lautet die Lebensweisheit des Nordens. Und wer diese Freiheit erlernt hat, der lässt sie sich auch in Corona-Zeiten nicht einfach so abknöpfen.
Die schwedische Regierung wird also – so lange es geht – vermeiden, die Freiheit der Bürger und die der Wirtschaft einzuschränken. Also spricht sie offizielle Empfehlungen aus und erlässt nur wenige Verordnungen. Inwiefern diese Empfehlungen bindend sind, darüber sind sich auch die Schweden nicht ganz einig. Empfehlungen liegen hier in einer Grauzone zwischen Rat und Recht. Verstanden hat es trotzdem jeder. Und diesen Rat erteilt nicht etwa die Regierung, sondern eine Expertengruppe. Im Fall der Covid-19-Strategie bedeutet dies, dass die Vertreter des schwedischen Gesundheitsamtes Folkhälsomyndigheten das Sagen haben .
Vertrauen entsteht durch Transparenz
Und diese Gruppe berichtet täglich um Punkt 14 Uhr live im schwedischen Fernsehen über die aktuelle Entwicklung und ihre Strategie. Über ihre Versäumnisse berichten sie natürlich auch. Sie hätten eher umfassend testen, die privatisierten Pflegeheime besser schützen und die Informationstexte für Einwanderer einfacher gestalten können. „Wir sind lernend.“ Und diese Offenheit der Berichterstattung sorgt für ein hohes Maß an Vertrauen in der schwedischen Bevölkerung.
Denn Vertrauen sinkt erst einmal nicht, wenn Fehler gemacht werden. Es sinkt, wenn man versucht sie zu kleinzureden und zu rechtfertigen . Das traditionell hohe Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung ist so in einem einzigen Monat noch einmal um 20 Prozent gestiegen.
Ihr seid alt genug, euch diszipliniert zu verhalten
Und dieses Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. So hat Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven die Gymnasiasten (also alle ab der 10. Klasse) vor ein paar Wochen mit folgenden Worten ins Home-Schooling entlassen: „Schüler, das ist kein extra Urlaub. Wir erwarten immer noch von euch, dass ihr euer Bestes gebt und versucht mit der Situation umzugehen. Ihr seid alt genug auf Distanz zu lernen und euch selbst zu disziplinieren. Ihr könnt das.“
Positive Leadership wäre dafür der passende Managementbegriff. Das sorgt dafür, dass die Menschen weitestgehend das tun, was von ihnen erwartet wird. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Dieser Managementstil ist typisch für schwedische Schulen und Unternehmen und sorgt für ein hohes Maß an Loyalität und Engagement. „Uppåtpuff“ nennen das die Schweden, „hochpuffen“, stolz machen, positive Zukunftsvisionen vermitteln.
Und dann loslassen!
Und dann versuchen „sie“, ihre Bürger, Mitarbeiter oder Schüler so weit wie möglich loszulassen. Tatsächlich zeigt die Forschung , dass Menschen, denen Vertrauen entgegengebracht wird, sich eher vertrauenswürdig verhalten. Klar, denn wenn uns etwas zugetraut wird, erfüllt uns das mit Stolz und lässt uns wachsen. Menschen sind im Allgemeinen dankbar und glücklich, wenn ihnen Freiheit geschenkt wird. Und dann möchte sich der Mensch dieser Ehre auch würdig erweisen und ist bereit, die sogenannte „extra Mile“ zu gehen.
Und das Durchhaltevermögen für diese extra Meile benötigen wir jetzt, denn Corona wird uns noch über Wochen, vielleicht sogar Monate begleiten. Deshalb versucht man, die Beschränkungen der schwedischen Bevölkerung so klein wie möglich zu halten, damit alle bereit sind, den Weg lange mitzugehen. Das ist einfach nur ein anderer Ansatz, der versucht dem Phänomen der psychologischen Reaktanz Rechnung zu tragen.
Sanktionen, die als zu hart, zu eingreifend, zu unnachvollziehbar erfahren werden, können nach einer gewissen Zeit auf Widerstand stoßen. Sie werden dann mehr oder weniger offensichtlich boykottiert. Unerwünschtes Verhalten kann sogar verstärkt werden. Die Presseveranstaltung der Experten vor zwei Tagen hat gezeigt, dass diese Strategie für die freiheitsliebenden Wikinger aufzugehen scheint. Die Motivation, sich an Regeln zu halten, flaut nicht etwa ab, sondern steigt täglich.
Und deshalb stehen die Schweden hier direkt vor meinem Laptop brav auf Abstand in einer Reihe. Vielleicht nicht genau 1,50 Meter, vielleicht 1,29 oder 1,67 Meter. Freiwillig und unkontrolliert. In Schweden geht man davon aus, dass sich 90 Prozent der Menschen vernünftig verhalten. Die meisten also. Nicht alle. Doch deshalb kontrolliert man doch nicht diese „alle“, sondern konzentriert sich lieber auf die wenigen, die sich des Vertrauens nicht würdig erweisen.
Unsicherheit ist Alltag
Schweden ist ein kleines Land. Niemand hat je auf Wikinger gewartet. Zumindest nicht freiwillig. Deshalb mussten sie von jeher alle Kräfte nutzen und sich kreativ auf jede Veränderung einstellen. Man weiß schließlich nie, woher die nächste Breitseite kommt. Veränderung ist ein Teil der schwedischen Lebensrealität. Das Gefühl der Unsicherheit lässt sie im Gegensatz zu uns Deutschen dementsprechend relativ kalt . Neues und Modernität, Automatisierung, Digitalisierung und Zukunft sind extrem positiv besetzte Begriffe.
Wikinger probieren lieber flexibel auf einer Welle mitzusurfen, anstatt sie aufzuhalten oder von ihr überrollt zu werden. Genau das versuchen sie jetzt mit der Coronawelle.
Digitaler Fortschritt in Schweden
Sie surfen allerdings auch schon seit Jahrzehnten leidenschaftlich durchs Netz und sind deshalb genauso, wie ihre skandinavischen Nachbarn unbeabsichtigt ausgezeichnet auf die Krise vorbereitet. Vieles läuft unter dem Radar der ausländischen Medien ab. Am 18. März 2020 erhielt ich zum Beispiel bereits eine Mail meiner Kommune, in der ich angeben sollte, ob mein Kind zu Hause einen Zugang zum Internet hat und über ein eigenes Tablet, einen PC oder ein Laptop verfügt. Wer dies nicht hatte, bekam es umgehend von der Kommune zur Verfügung gestellt, denn auch bei Home-Schooling sollen alle dieselben Chancen haben. An jeder Milchkanne. Auch, wenn es bisher nicht eingesetzt wurde.
Und das ist keine so große Investition, da 75 Prozent aller Kinder ab der 7. Klasse über ein Schul-Tablet verfügen, 100 Prozent aller Kinder ab der 10. Klasse haben darüber hinaus einen eigenen Schul-Laptop. Dieses Projekt, Schulen mit Laptops auszustatten, hat die schwedische Regierung im Jahre 2006 gestartet.
Die Vorbereitungen begannen vor Jahrzehnten
Die schwedische Unerschrockenheit und Offenheit gegenüber allem Neuen hat dazu geführt, dass Digitalisierung niemals verteufelt wurde. So ist sie seit den 1990er Jahren tief in die Gesellschaft eingedrungen. Homeoffice und das damit verbundene Vertrauen in seine Mitarbeiter, wie auch die notwendige Hard- und Software, sowie die zugehörigen Kompetenzen, wurden jahrelang erprobt. Und jetzt einfach eingesetzt.
Die meisten öffentlichen, aber auch wirtschaftlichen Prozesse sind hoch digitalisiert und vernetzt: Beim Arbeitsamt melden, elektronische Briefkästen leeren, Steuererklärungen einreichen, Adressänderungen übermitteln, Sozialversicherung beantragen, den Arzt über eine App konsultieren, Verträge unterzeichnen oder telefonische Beratung. Überall kann man sich digital identifizieren. So kommen alle weiter, ohne das Haus zu verlassen. Auch schon vor Corona.
Die Schweden bleiben zuversichtlich und positiv gestimmt
Ich hoffe, Sie verstehen nun besser die Wurzeln des schwedischen Weges, den ich mir in Zukunft für alle wünschen würde. Dass Vertrauen und Zutrauen schon in den Kinderseelen tief verankert werden würde, anstatt Kontrolle und Leistungsdruck. Dass Kinder durch positive Führung lernen, sich als vollständige und eigenständige und somit mündige Mitbürger zu entwickeln.
Drei starke Glückstreiber werden in Schweden bedient: gute Beziehungen, durch freiwillige Rücksichtnahme. Die Freiheit auf Basis von Transparenz und Empfehlungen frei entscheiden zu dürfen. Und nicht zuletzt das enorm hohe Vertrauensniveau, welches in der Gesellschaft herrscht. Mit diesen drei Glückstreiber kommt man auch glücklich durch eine Krise und ist somit um 20 Prozent produktiver, kreativer und kooperativer. Und genau das benötigen wir jetzt, um Visionen für eine mögliche Zukunft zu gestalten. Wie auch immer sie aussehen mag. Welcher Weg auch immer der „richtige“ sein möge. Lasst und nicht über einander urteilen, sondern gemeinsam demütig lernen.
Ich wünsche uns allen Mut und Visionen!
Maike van den Boom verhilft Unternehmen zum Glück. Sie inspiriert als Keynote-Speaker, überzeugt als Skandinavien-Kennerin und begleitet Unternehmen langfristig in eine glückliche, boomende Zukunft. Ihr letztes Buch erschien 2018 bei Fischer-Krüger: „Acht Stunden mehr Glück – warum die Skandinavier glücklicher arbeiten und was wir von ihnen lernen können“. In ihrem Blog schreibt die Bestsellerautorin rund um die Themen Glück in Gesellschaft und Unternehmen. Maike van den Boom ist Mitorganisatorin des European Bildung Networks und wohnt in Stockholm