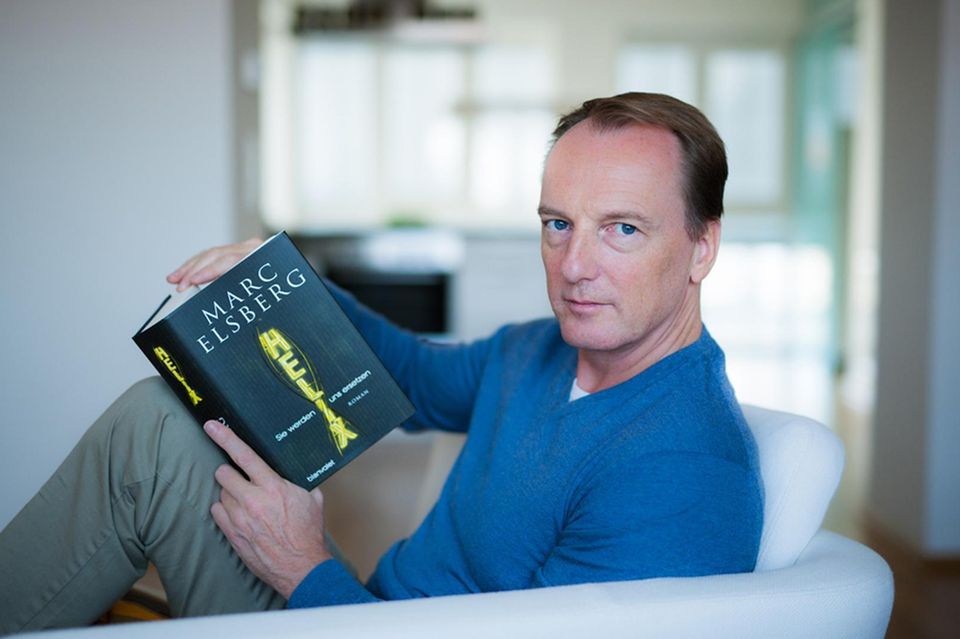Robert Skidelsky ist Mitglied des britischen Oberhauses und emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Warwick.
Ich glaube, dass die Schotten vernünftig sind und deshalb werden sie meiner Meinung nach der Unabhängigkeit eine Absage erteilen. Doch ungeachtet des Abstimmungsergebnisses ist der spektakuläre Aufstieg des Nationalismus in Schottland und in anderen Teilen Europas Symptom eines kranken politischen Mainstreams.
Vielerorts ist man heutzutage überzeugt, dass die Art und Weise wie unsere Angelegenheiten derzeit geregelt werden, keine bedingungslose Loyalität verdient; dass das politische System eine ernsthafte Debatte über wirtschaftliche und soziale Alternativen verweigert; dass Banken und Oligarchen herrschen; und dass die Demokratie eine Mogelpackung ist. Der Nationalismus verspricht einen Ausweg aus dem Ordnungssystem „sinnvoller“ Alternativen, die sich später als alternativlos herausstellen.
Nationalisten lassen sich in zwei Gruppen einteilen: die einen glauben wirklich, dass Unabhängigkeit einen Ausweg aus einem blockierten politischen System darstellt, während die anderen mit der Androhung der Unabhängigkeit Zugeständnisse des politischen Establishments erzwingen wollen. In beiden Fällen genießen nationalistische Politiker den enormen Vorteil, dass sie kein praxistaugliches Programm benötigen, denn alles Gute kommt ohnehin mit der staatlichen Souveränität.
Agrenzung gegen etwas „Anderes“
Obwohl nationalistische Politik nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund des wirtschaftlichen Wohlstandes und der Erinnerungen an die Schrecken der Vorkriegszeit lange Zeit niedergehalten wurde, fällt sie in Europa heute wieder auf fruchtbaren Boden. Dies nicht nur aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Malaise Europas, sondern weil in praktisch allen bestehenden Nationalstaaten Europas ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten in geographisch abgegrenzten Gebieten leben. Außerdem stellt die Einbindung dieser Staaten in die Europäische Union – eine Art freiwilliges Imperium – eine Herausforderung für die Loyalität der Bürger dieser Staaten dar. Die Nationalisten können sich daher Europa zuwenden, um die Bürger vor ihrem eigenen Staat zu beschützen oder sie konzentrieren sich auf ihren Staat, um ihn vor dem europäischen Imperium zu beschützen.
Das ist der auch der Grund, warum Großbritannien zwei Nationalismen gleichzeitig hervorbrachte. Die von dem Populisten Nigel Farage angeführte britische Unabhängigkeitspartei UKIP stellt London in den Mittelpunkt, um die britische Unabhängigkeit vor der EU-Bürokratie zu beschützen. Die Schottische Nationalpartei (SNP) unter der Führung des cleveren Alex Salmond wendet sich Brüssel zu, um Schottland vor dem „imperialen“ Parlament in Westminster zu bewahren. Unter den richtigen Bedingungen findet der Nationalismus immer etwas „Anderes“, gegen das es sich abzugrenzen gilt.
Der schottische Nationalismus hat seinen Ursprung nicht in der jüngsten Wirtschaftskrise, das schottische Referendum jedoch sehr wohl. Schottland etablierte sein erstes dezentrales Parlament im Jahr 1999, wodurch die SNP in Edinburgh eine politische Plattform erhielt, von der aus sie ihre Kampagne für die Unabhängigkeit führen konnte. Mit der Abwahl der Labour-Regierung in London im Jahr 2010 bestraften die Wähler die Labour Party für den wirtschaftlichen Zusammenbruch in den Jahren 2008/2009. Doch während die Bestrafung der Labour Party in London zu einer konservativen Regierung führte, bewirkte sie in Edinburgh im Jahr 2011 die absolute Mehrheit der SNP bei den Parlamentswahlen. Um die Regierbarkeit in Schottland weiterhin zu gewährleisten, war der britische Premierminister David Cameron gezwungen, einem Referendum über die Unabhängigkeit zuzustimmen.
Ein unabhängiger schottischer Staat wäre mit enormen volkswirtschaftlichen Kosten konfrontiert. Er würde zwar den Anteil an den Staatschulden und künftigen Verbindlichkeiten Großbritanniens erben, doch die beträchtlichen Subventionen, die man derzeit aus dem britischen Finanzministerium erhält, würden ausbleiben. Die SNP behauptet, diese fehlenden Subventionen würden durch zusätzliche Einnahmen aus dem Nordseeöl ausgeglichen werden. Doch diese Einnahmen sind naturgemäß zeitlich begrenzt und die hohen Stilllegungskosten, die anfallen, wenn das Öl einst nicht mehr fließt, lässt man bei der SNP unter den Tisch fallen. Deshalb werden die Steuern in Schottland fast sicher höher sein müssen als in Großbritannien. Zudem ließen führende, in Schottland ansässige Banken und viele große Unternehmen verlauten, dass sie einen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten nach London verlagern würden. Schottland würden auch britische Aufträge im Verteidigungssektor entgehen.
Der Traum von der schottischen Sozialdemokratie
Den Angaben der SNP zufolge würde ein unabhängiges Schottland zu keiner Fragmentierung des britischen Binnenmarktes führen, weil man in einer Währungsunion mit Großbritannien bliebe. Doch die drei wichtigsten politischen Parteien Großbritanniens und die Bank of England lehnen dieses Ansinnen ab. Wenn die Schotten staatliche Souveränität wollen, brauchen sie auch eine eigene Währung – und ihre eigene Zentralbank: Den schottischen Banken stünde kein britischer Kreditgeber letzter Instanz zur Verfügung.
Schottland könnte versuchen, seine Währung auf dem gleichen Kurs wie das Pfund zu halten, doch das würde, zumindest zu Beginn, höhere Reserven erfordern, als die schottische Zentralbank aufbringen könnte. Und eine schottische Währung mit flexiblem Wechselkurs gegenüber dem britischen Pfund hätte hohe Transaktionskosten und einen schrumpfenden Handel zwischen den beiden Ländern zur Folge.
Zumindest auf kurze Sicht ist auch ein EU-Beitritt kein einfacher Ausweg, denn die EU würde von einem unabhängigen Schottland wohl verlangen, die Mitgliedschaft zu beantragen.
Kurzum: der Traum der SNP von Sozialdemokratie in einem Land würde an den übergeordneten Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Teilbereichen Großbritanniens ebenso scheitern, wie an den Verbindungen zwischen Großbritannien und der EU sowie jenen der EU und dem Rest der globalisierten Welt.
Kosten des Nationalismus werden unterschätzt
Auf dem Vormarsch des Nationalismus im Europa nach dem Crash bedienen sich die Protagonisten dieser Entwicklung oftmals der Einwanderung, um die Ressentiments aus der Zeit vor dem Crash auszunutzen. Dabei geht es vor allem um die Erosion der Kulturen und Identitäten, ein schwindendes Gemeinschaftsgefühl, die Stagnation der Löhne, steigende Ungleichheit, unkontrollierte Banken und hohe Arbeitslosigkeit. Sie fragen sich, ob die Menschen in den Genuss der Vorteile der Globalisierung kommen und gleichzeitig vor ihren Kosten abgeschirmt werden können – und welche Alternativen zum „Marktfundamentalismus“ bestehen, der den Kapitalismus seit dem späten 20. Jahrhundert definiert.
In einer derartigen Stimmung sind die Menschen eher geneigt, die Kosten des Nationalismus unberücksichtigt zu lassen, weil sie an den Vorteilen seiner liberalen kapitalistischen Konkurrenz zweifeln. Gewöhnliche Russen beispielsweise weigern sich den Preis der Ukraine-Politik ihrer Regierung zur Kenntnis zu nehmen. Dies nicht nur, weil sie ihn unterschätzen, sondern weil sie ihn im Vergleich zu dem enormen psychologischen Auftrieb, den diese Politik mit sich bringt, als irgendwie unwichtig erachten.
Der Nationalismus von heute ist nicht annähernd so gefährlich wie in den 1930er Jahren, weil die wirtschaftliche Not viel weniger stark ausgeprägt ist. Doch seine Wiederbelebung lässt erahnen was geschieht, wenn eine Form der Politik für sich in Anspruch nimmt, jedes menschliche Bedürfnis mit Ausnahme des positiven Gefühls der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft zu befriedigen – und die Menschen dann im Stich lässt.
Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier
© Project Syndicate 1995–2014