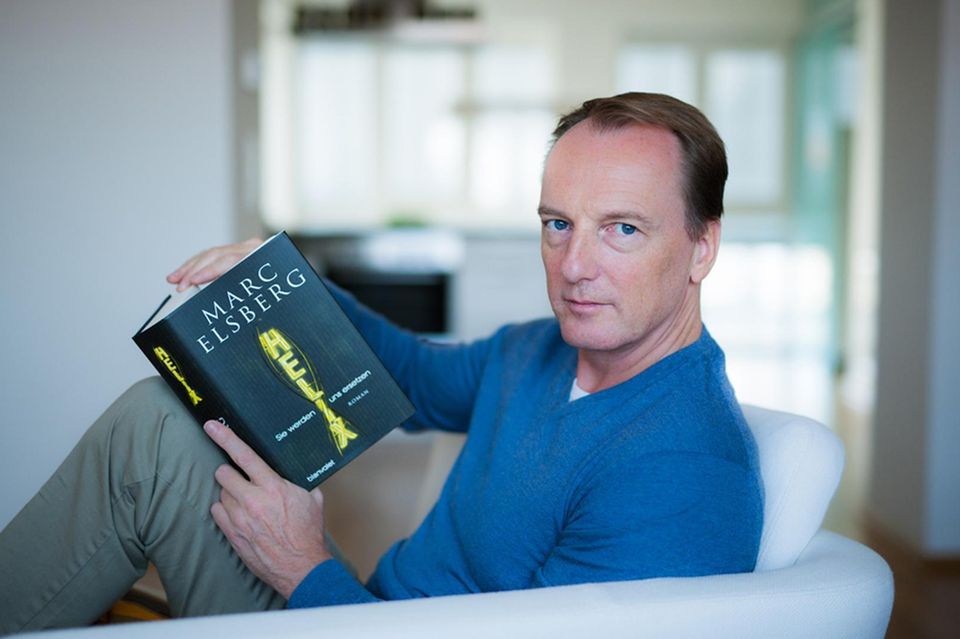Banker-Bashing steht mal wieder hoch im Kurs. Nachdem die EU-Kommission wegen der Manipulation des Libor und des Euribor Strafzahlungen in Höhe von insgesamt 1,7 Mrd. Euro gegen sechs europäische Banken erlassen hat, überbieten sich Politiker und Journalisten wieder einmal darin, einen ganzen Berufsstand in Grund und Boden zu reden bzw. zu schreiben.
Es ist also höchste Zeit, ein wenig nüchterner auf die Lage zu blicken und sich mit zwei Fragen zu beschäftigen: Was ist schief gelaufen? Und was können wir daraus lernen?
Zunächst zu dem, was schief gelaufen ist: In den vergangenen 30 Jahren hat die Wertpapierindustrie einen gigantischen Aufschwung erlebt. Er verlief – wie in Boomphasen häufig der Fall – exponentiell. Das heißt: Je näher sich die Hausse ihrem Ende näherte, desto rasanter wurde das Wachstum.
Im Wertpapierbereich, der weitgehend von Investmentbanken dominiert wird und aus Produktion, Vertrieb und Handel besteht, ist die Zahl der Beschäftigten in den USA zwischen 1998 und 2007 um mehr als 30 Prozent gestiegen. Die Gehälter kletterten im gleichen Zeitraum real um 25 Prozent pro Kopf, im Rest der Wirtschaft gerade einmal um sieben Prozent. Und während 1978 ein Mitarbeiter in der Wertpapierindustrie doppelt soviel verdiente wie ein Angestellter außerhalb des Finanzsektors, lag das Verhältnis 2008 bei fünf zu eins.
Beitrag zu Wachstum und Wohlstand
Mit dem Wachstum des Sektors stieg die Macht der Wertpapierspezialisten sowohl in- als auch außerhalb der Banken. Denn nicht nur die Aktionäre freuten sich über stetig steigende Gewinne im Investmentbanking. Auch Staaten bzw. Kommunen profitierten von hohen Steuereinnahmen aus der Finanzindustrie und konsumfreudigen Bankern, die die Kassen in Feinkostläden, Ferrari-Filialen und Luxus-Restaurants klingeln ließen. In Großbritannien ist die Entwicklung sogar soweit gegangen, dass die gesamte Volkswirtschaft maßgeblich von der Wertpapierindustrie in der City of London abhängig ist – bis heute.
Im Ergebnis hatte diese Entwicklung positive und negative Seiten. Einerseits hat die Wertpapierbranche beträchtlich zum Wohlstand und zum Wachstum der Realwirtschaft beigetragen. Sie hat aus illiquiden Forderungen wie etwa Krediten handelbare Wertpapiere gemacht. Sie sorgt dafür, dass sich Industrieunternehmen gegen Preisschwankungen absichern und große Finanzierungen rund um den Globus stemmen können. Und sie bietet Anlegern die Möglichkeit, nicht mehr nur von ein paar Spar- und Anlageangeboten von Banken und Versicherungen abhängig zu sein, sondern zum Beispiel über Indexfonds deutlich preisgünstiger am Wachstum der Wirtschaft teilzuhaben.
Aber das rasante Wachstum der vergangenen 30 Jahre hat auch Schattenseiten. Das Wertpapiergeschäft hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr seine eigenen Regeln gegeben. Manches ist offensichtlich außer Kontrolle geraten. Die Manipulationen des Libor, des Euribor und womöglich sogar anderer Preise sind dafür das markanteste Beispiel. Der Wettlauf um immer höhere Renditen und die Gier nach Bonuszahlungen hat dazu geführt, dass selbst einstmals langweilige Landesbanken, deren Hauptaufgabe eigentlich das regionale Kreditgeschäft ist, zu wilden Zockerbuden wurden – übrigens unter der Aufsicht von Politikern.
Heilsame Bereinigungskrise
Nun stellt sich die Frage, was zu tun ist. Sollte die Politik dem 30-jährigen Boom der Wertpapierindustrie und damit auch den Investmentbanken über die Regulierung den Garaus machen?
Vor diesem Weg kann ich nur warnen. Die Wirtschaftsgeschichte lehrt, dass das rasante Wachstum eines bestimmten Industriezweigs häufig mit extremen Auswüchsen verbunden ist, die in der dann folgenden, unvermeidlichen Krise ans Tageslicht kommen. Im Anschluss daran folgt eine heilsame Bereinigungskrise, in der alle Akteure gut beraten sind, nüchtern die Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit zu ziehen und schlichtweg die Spreu vom Weizen zu trennen.
Es muss also darum gehen, diesen für die Realwirtschaft wie für Privatanleger wichtigen Teil der Finanzindustrie robuster zu machen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass die Festsetzung von Referenzzinsen und -preisen durch staatliche Instanzen vorgenommen oder zumindest strikt überwacht werden muss. Dazu gehört, dass für die Wertpapierhändler die Zeit des leichten Geldverdienens mit aberwitzigen Boni vorbei ist und sie sich ausschließlich auf das Kundengeschäft konzentrieren müssen. Und dazu gehört auch, dass sich die Banken selbst Gedanken machen müssen, wie sie ihre Geschäftsmodelle an ein neues Umfeld anpassen, in dem Kunden, Politik und Gesellschaft Exzesse wie in der Vergangenheit nicht mehr akzeptieren. Sie wären gut beraten, hier aktiv voranzugehen anstatt sich von der Politik treiben zu lassen.
Denn wenn Politik und Finanzbranche nicht an einem Strang ziehen und gemeinsam versuchen, die Vorteile einer modernen, innovativen Wertpapierindustrie zu nutzen, wird das Unternehmen wie Privatanlegern und damit letztlich unserer Volkswirtschaft massiven Schaden zufügen.