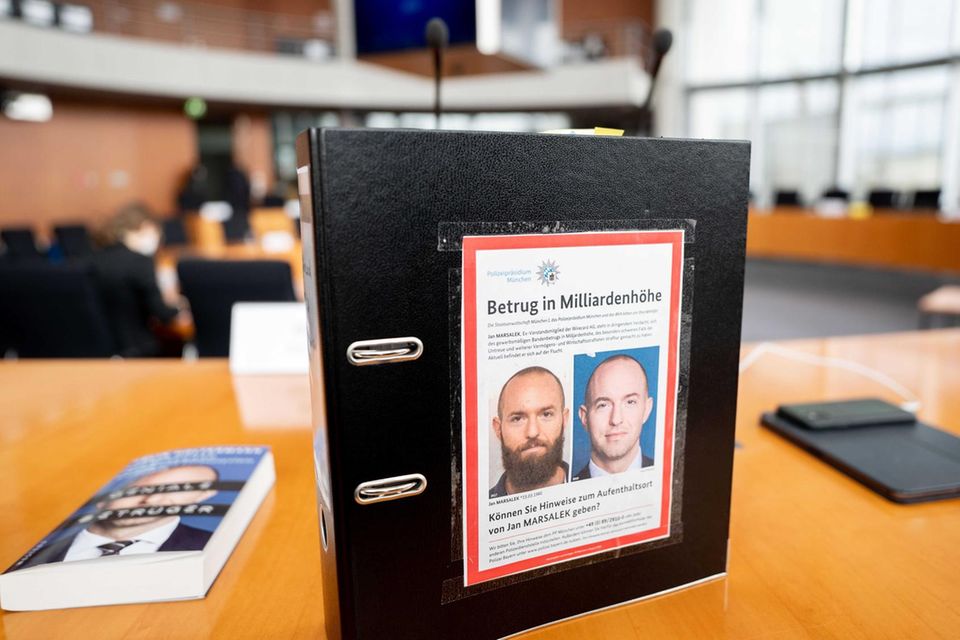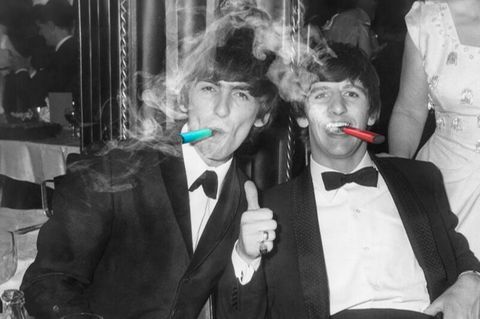Ökonomen und Gewerkschafter halten nicht viel von der Idee, dass der erste Krankheitstag den Arbeitnehmern Geld kosten soll. Diese Idee eines Karenztages hat Allianz-Chef Oliver Bäte im Interview mit dem „Handelsblatt“ auf den Tisch gebracht. Der renommierte Arbeitsforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wies den Vorstoß zurück. „Karenztage dürften zwar den Krankenstand senken, aber letztlich betreffen sie nicht nur Blaumacher, sondern auch die tatsächlich Kranken“, sagt Weber zu Capital. „Um Nachteile zu vermeiden, würden also auch Kranke zur Arbeit gehen. Das hat Risiken: Ansteckungen, verschleppte Krankheiten, Stress und Folgeerkrankungen.“
Auch andere Experten kritisierten Bätes Äußerungen. „Das ist ein Vorstoß, der nicht gerade auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert“, sagte ZEW-Ökonom Nicolas Ziebarth im Gespräch mit Capital. „In Ländern mit Karenztagen geht die Tendenz eher in unsere Richtung. Zum Beispiel in Spanien, England und Schweden. Vor allem, weil wir mittlerweile wissen, wie stark sich Infektionskrankheiten in Betrieben ausbreiten.“
Weber sagte, es sei durchaus plausibel, über Wege zu geringeren Krankenständen nachzudenken. Neben Karenztagen gebe es andere Mittel, etwa eine kürzere Frist zur Attestpflicht. Der Arbeitgeber könne das auch jetzt schon verlangen. Insofern liegt eine Lösung in den Unternehmen selbst: „Das offene Gespräch suchen, nötigenfalls Attest ab dem ersten Tag einfordern“, so Weber. „Das wäre zielgenauer.“
Gewerkschaften schließen sich Ökonomen an
Nicht nur Ökonomen lehnen die Idee ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor einer zunehmenden Tendenz bei Beschäftigten in Deutschland, trotz Krankheit zu arbeiten. „Präsentismus“, also krank bei der Arbeit zu erscheinen, ist branchenübergreifend weit verbreitet“, sagte Anja Piel vom DGB-Bundesvorstand am Montag in Berlin.
Die Gewerkschafterin hielt Bäte entgegen, die Entgeltfortzahlung bei Krankheit sei ein hohes Gut angesichts des Umstands, dass immer mehr Menschen trotz Krankheit arbeiteten. „Niemand braucht aktuell Vorschläge, die noch mehr Beschäftigte dazu bringen, krank zu arbeiten“, sagte Piel.
Allianz-Chef Bäte sieht den hohen Krankenstand in Deutschland als Kostenproblem. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 2023 durchschnittlich 15,1 Arbeitstage krankgemeldet. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit weist für 2023 sogar einen noch höheren Durchschnittswert aus: Demnach hatte weit über die Hälfte der DAK-Versicherten von Januar bis Dezember 2023 mindestens eine Krankschreibung. Im Gesamtjahr waren es laut DAK im Durchschnitt 20 Fehltage pro Kopf. Europaweit liege sie laut Bäte bei acht Tagen. Doch woher Bäte die acht Tage nimmt, ist unklar. Eine Anfrage von Capital ließ die Allianz bislang unbeantwortet. Ökonomen kennen die Zahl jedenfalls nicht.
Ohnehin seien Krankheitstage eine wacklige Statistik, mahnen Ökonomen. Es gebe keine repräsentativen Daten, sondern bestenfalls die Krankmeldungen bei den Krankenkassen. Diese gehen aber erst ein, wenn ein Angestellter beim Arzt war und dieser die elektronische Krankschreibung weiterleitet. Alles unter drei Tagen, beispielsweise ein kleiner Schnupfen – oder eben der berühmte Brückentag des Blaumachers, werde systematisch untererfasst.
Auf europäischer Ebene sei die Datenlage noch diffuser. „Ich kenne keinen Indikator, der international vergleichbar ist. Das heißt also, man muss extrem vorsichtig sein mit dem Vergleich, ob Deutsche häufiger krank sind als Menschen in anderen Ländern“, sagte Ziebarth. Grundsätzlich sei wissenschaftlich zwar klar belegt, dass großzügigere Lohnfortzahlung mit mehr Krankheitstagen einhergeht. Doch der Unterschied – 20 Tage in Deutschland gegen acht Tage in Europa – zweifelt Ziebarth stark an.
Kein dramatischer Anstieg der Fehlzeiten
Auch Gewerkschafterin Piel sagt, das Bild zu Krankschreibungen zeige derzeit keinen Handlungsbedarf. Das DGB-Bundesvorstandsmitglied führte Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an, die keinen dramatischen Anstieg der Fehlzeiten in Deutschland zeigten, weder im Vergleich mit anderen EU-Staaten, noch im Zeitverlauf.
„Schon vor Corona gaben etwa 70 Prozent der Beschäftigten an, mindestens einmal im Jahr krank zur Arbeit erschienen zu sein und im Durchschnitt fast neun Arbeitstage pro Jahr trotz Erkrankung gearbeitet zu haben“, sagte Piel unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage. Präsentismus schade der eigenen Gesundheit und könne auch zur Ansteckung von Kolleginnen und Kollegen oder Unfällen führen - mit hohen Folgekosten.
Die IG Metall bezeichnete es als unverschämt und fatal, den Beschäftigten Krankmacherei zu unterstellen. „Wer Karenztage aus der Mottenkiste holt, greift die soziale Sicherheit an und fördert verschleppte Krankheiten“, sagte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban. „Die deutsche Wirtschaft gesundet nicht mit kranken Beschäftigten, sondern im Gegenteil mit besseren Arbeitsbedingungen.“
Unionspolitiker offen für „neue Ideen“
Der Unions-Fraktionsvize Sepp Müller (CDU) zeigt sich indes offen für die Idee, dass Arbeitnehmer am ersten Krankheitstag keinen Lohn erhalten. „Unsere Sozialsysteme werden immer weiter beansprucht“, sagte Müller dem Nachrichtenportal „Politico“. „Aus diesem Grund sollten wir uns meiner Meinung nach nicht vor neuen Ideen verschließen und diese diskutieren. Auch wenn das Thema der Karenztage sich nicht in unserem Wahlprogramm findet, könnte dies ein altbewährter Ansatz sein.“
Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), sagte dem Portal hingegen: „Nur die allerwenigsten Menschen melden sich aus Spaß krank.“ Sorge forderte einen „Krankenstands-Gipfel“, um mit den beteiligten Akteuren über die Lage zu beraten.
Mit Agenturmaterial