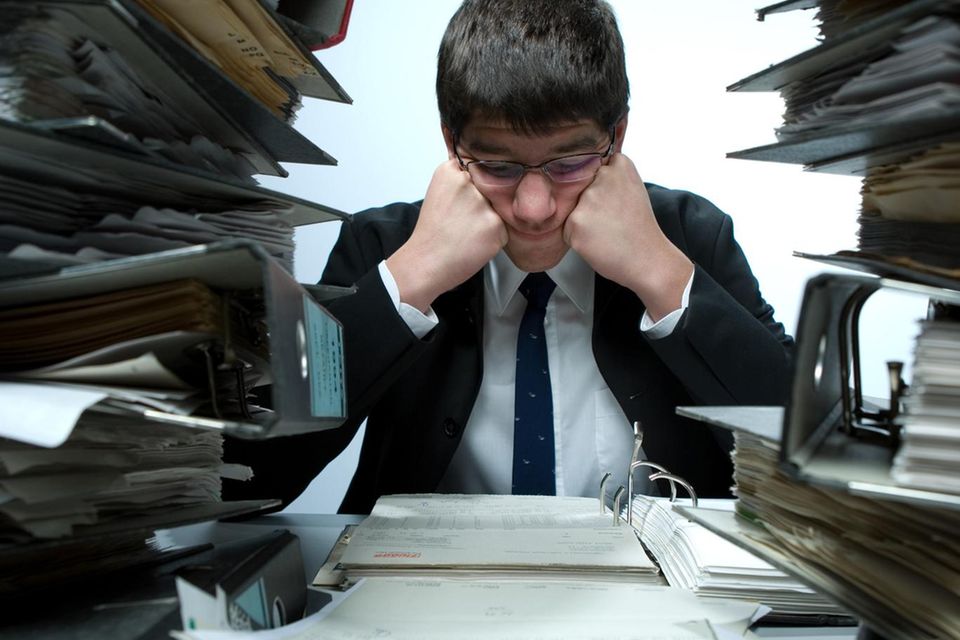Im Vorstand der Bundesbank führt Carl-Ludwig Thiele das Ressort Bargeld, Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme. Seit Mitte Januar 2015 ist er auch für die Themen Ökonomische Bildung, Hochschule und Technische Zentralbank-Kooperation zuständig.
Herr Thiele, wie viel Bargeld tragen Sie normalerweise im Portemonnaie?
Das ist unterschiedlich. Wenn ich mit der Familie unterwegs bin, achte ich auf einen höheren Bargeldbestand als wenn ich alleine unterwegs bin. Kleinbeträge zahle ich bar, die Karte nutze ich für größere Zahlungen.
Es heißt, Bargeld sei bereits ein Auslaufmodell.
Was viele überraschen dürfte ist die Tatsache, dass der Bargeldumlauf pro Jahr um über fünf Prozent steigt. Das liegt deutlich über der Inflationsrate. Der Zuwachs entfällt auch nicht allein auf die großen Banknotennominale. Der am häufigsten verwendete Schein ist der 50-Euro-Schein, danach kommt der 20-Euro-Schein. Die Bundesbank führt regelmäßig repräsentative Zahlungsverhaltensstudien durch. Die Ergebnisse belegen, dass am Verkaufspunkt, dem Point of Sale, gut 80 Prozent der Käufe bar bezahlt werden. Das gilt insbesondere bei kleineren Beträgen. Wertmäßig werden dagegen nur etwas mehr als 50 Prozent bar bezahlt.
Was ist der Grund für den steigenden Bargeldumlauf?
Bargeld eignet sich sehr gut als Wertaufbewahrungsmittel. Auch im Ausland werden Euro-Banknoten gerne für diesen Zweck genutzt. Zudem reisen die Deutschen sehr gerne ins Ausland und geben dort dann auch Euro-Bargeld aus. Der steigende Bargeldumlauf kann also unter anderem durch die starke Auslandsnachfrage erklärt werden.
"Wir überlassen es dem Bürger"
Sind die Deutschen im internationalen Vergleich besonders bargeldaffin?
Die Frage, ob in Deutschland am Point of Sale tendenziell eher bar bezahlt wird als in anderen Ländern, lässt sich derzeit nur sehr schwer beantworten. Ländervergleiche sollten – was den Barzahlungsverkehr betrifft – nur sehr vorsichtig interpretiert werden. Bei der Untersuchung der internationalen Unterschiede in der Bargeldnutzung sind noch viele Fragen offen und im Moment Gegenstand wissenschaftlicher Studien. Wir vermuten, dass sich eine Vielzahl von Faktoren auf die Bargeldhaltung, die Zahlungsgewohnheiten allgemein und die Barzahlungsquote auswirkt.
Zum Beispiel?
Das können historische Entwicklungen sein, demografische Faktoren, die Präferenzen und Zahlungsgewohnheiten der Konsumenten, aber auch institutionelle Faktoren oder die vorhandene Infrastruktur. Die Österreicher sind beispielsweise ähnlich bargeldaffin wie die Deutschen. Konsumenten in Deutschland schätzen das Bargeld besonders wegen der hohen Akzeptanz, den geringen Kosten, der Anonymität und der Schnelligkeit der Zahlung – und auch weil es ein einfaches Mittel zur Ausgabenkontrolle ist.
Länder wie Schweden forcieren den Abschied vom Baren, im Alltag kann man dort oft nur noch mit Karte zahlen. Ein Vorbild?
Die Bundesbank hat den gesetzlichen Auftrag, für den baren und unbaren Zahlungsverkehr in Deutschland zu sorgen. Diesen Auftrag erfüllen wir, wobei wir es dem Bürger überlassen, wie er zahlt. Jedes Land hat seine eigene Kultur und seine eigenen Bedingungen. Schweden ist flächenmäßig deutlich größer als Deutschland, hat aber nur ein Zehntel der Bevölkerung. In einem Land mit dünner Besiedelung ist der relative Aufwand für die Bargeldlogistik natürlich höher, so dass die dortige Gesellschaft bzw. der Gesetzgeber darüber zu entscheiden hat, ob die Kosten-Nutzen-Relation die Bereitstellung des Zahlungssystems „Bargeld“ rechtfertigt.
In der Schattenwirtschaft ist das Bare ganz besonders beliebt.
Bargeld wird weit überwiegend für legale Transaktionen verwendet, bei denen manchmal auch die Identität geheim bleiben soll. Denken Sie nur an den Kauf von Weihnachtsgeschenken. Es gibt zudem das schöne Zitat von Dostojewski: „Bargeld bedeutet doch geprägte Freiheit.“ Der Bürger kann – ohne sich gegenüber einem Dritten erklären zu müssen – darüber frei verfügen, denn es ist ja sein Geld.
Es gibt den Vorschlag, zumindest die ganz großen Scheine abzuschaffen. Warum nicht auf die 500-Euro-Note verzichten?
Über die Stückelungsstruktur der Euro-Banknoten wurde des Öfteren diskutiert, aber nach der Beschlusslage im Eurosystem bleibt uns der 500er erhalten. Das Abschaffen von Bargeld insgesamt oder einer Stückelung wie dem 500-Euro-Schein würde das Problem schattenwirtschaftlicher Aktivitäten nicht lösen.
Das wird aber oft behauptet.
Der Ökonom Gabriel Zucman schätzt die weltweite Summe nicht-deklarierter Privatvermögen auf 5.800 Milliarden Euro. Der gesamte Umlauf an 500-Euro-Scheinen beläuft sich dagegen auf knapp 300 Milliarden. Das zeigt, dass die Existenz von Bargeld kaum notwendige und hinreichende Voraussetzung für schattenwirtschaftliche Aktivitäten sein kann. Mit den 200- und 500- Euro-Scheinen haben wir in Europa deutlich höhere Nominale als in den USA, wo der größte Schein die 100-Dollar-Note ist. Mir ist aber nicht bekannt, dass es in den USA deshalb weniger Kriminalität gäbe als bei uns.
"Wir bleiben neutral"
Euro-Länder wie Italien oder Griechenland haben Obergrenzen für Barzahlungen festgelegt. Ist das in Ordnung?
Darüber entscheidet allein der nationale Gesetzgeber. Der Deutsche Bundestag hat übrigens in Deutschland im Bereich des Steuerrechtes einen ähnlichen Weg beschlossen: Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Handwerkerleistungen bei selbstgenutztem Wohneigentum oder bei haushaltsnahen Dienstleistungen erhalten Sie nur, wenn Sie nachweisen, dass der Betrag bargeldlos gezahlt wurde.
Irritiert es Sie, wenn heute auch in der Finanzwirtschaft auf einen „Krieg gegen das Bargeld“ gesetzt wird?
Es geht bei diesem „War on Cash“ um verschiedene Interessen. Besonders die Kreditinstitute sehen die Bargeldversorgung eher als Kostenfaktor, während sie im elektronischen Zahlungsverkehr am Point of Sale eher Erträge generieren können. So lassen sich etwa im Kartengeschäft unter anderem über Jahresgebühren und Händlerentgelte Erträge erzielen. Das ist ein lukrativer Markt, in dem viele wachsen wollen. Für die Bürger ist aber erst einmal etwas ganz Anderes wichtig. Ist das Geld sicher aufgehoben? Bleibt die Währung stabil? Das zu gewährleisten ist unsere Aufgabe als nationale Notenbank. Wir wollen niemandem vorschreiben, wie er zu zahlen hat, sondern bleiben neutral. Unser gesetzlicher Sorgeauftrag umfasst den baren und bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Sogar Apple steigt in das Zahlungsgeschäft ein. Könnten Apple Pay oder ein iGeld einmal die Banknoten verdrängen?
In den vergangenen Jahren haben sich verschiedene neue Zahlungsverfahren entwickelt – teils mit Blick auf die Besonderheiten des E-Commerce, wie bei PayPal. Oder es wird nach Wegen gesucht, das Smartphone auch für das Bezahlen an der Kasse zu nutzen. Viele dieser innovativen Verfahren basieren letztlich auf den klassischen Instrumenten Überweisung, Lastschrift oder Kreditkarte. Nutzergewohnheiten ändern sich natürlich im Laufe der Zeit, aber erfahrungsgemäß dauert es länger, bis sich im Zahlungsverkehr Neuerungen auf breiter Basis durchsetzen. Ich halte es für vollkommen illusorisch, auf mittlere oder längere Sicht von einer bargeldlosen Gesellschaft auszugehen.
In unserer neuen Ausgabe (am 22. Januar im Handel) beschäftigen wir uns in einem Themenschwerpunkt mit der Zukunft des Geldes. Ein Thema: Das Ende des Bargelds - Unternehmen und Ökonomen wollen uns Münzen und Scheine austreiben.
Hier können Sie sich ab dem 22. Januar die iPad-Ausgabe herunterladen. Hier geht es zum Abo-Shop, wenn Sie die Print-Ausgabe bestellen möchten.