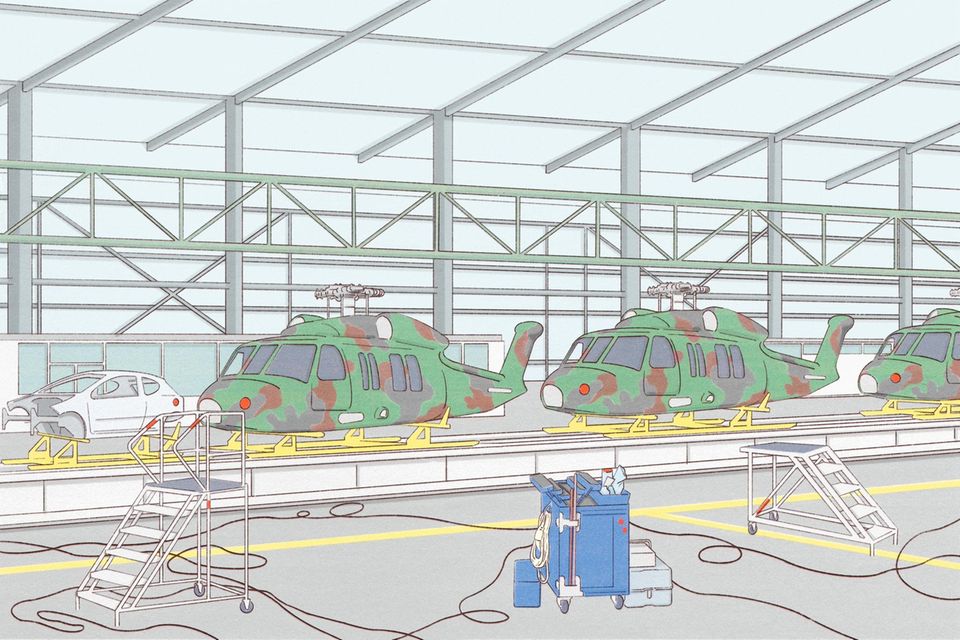Photovoltaik-Module auf dem Balkon, im Garten oder auf der Garage versorgen den Haushalt mit grünem Strom. Sie sind leicht zu montieren und die Kosten für die Anschaffung sind überschaubar. Wenig verwunderlich, dass sich die kleinen Anlagen großer Beliebtheit erfreuen: Laut einer aktuellen Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur durch das Datenportal Statista waren im August 2023 bundesweit rund 300.000 Steckersolargeräte in Deutschland installiert – gut dreimal so viele wie im Dezember des Vorjahres.
Für viele Menschen dürfte es künftig wesentlich schneller gehen, ihr Balkonkraftwerk in Betrieb zu nehmen. Das Bundeskabinett hat Mitte August ein Solarpaket beschlossen, Steckersolargeräte werden dadurch zu einer neuen Kategorie von Solaranlagen im Erneuerbare-Energiegen-Gesetz (EEG). Damit dürften viele bürokratische Hürden für Mieter und Eigentümer wegfallen. Das soll dazu beitragen, den Ausbau der Solarenergie in Deutschland zu beschleunigen. In Kraft treten könnte die Regelung bereits zum neuen Jahr.
Das müssen Interessierte aktuell beachten
Ein Steckersolargerät besteht aus einem oder mehreren Photovoltaikmodulen und einem integrierten Wechselrichter, der den Solar-Strom in Haushaltsstrom umwandelt. Über einen Steckdosenstecker lässt sich die Anlage ganz leicht anschließen. Der produzierte Strom kann direkt verbraucht werden – und senkt so die Energierechnung.
Damit die Balkonkraftwerke sicher sind, müssen Nutzer die Solarpaneele fest montieren. Zudem sollten sie die Anlagen in deutschen Onlineshops oder beim lokalen Elektriker kaufen. Denn auch ein Gerät aus einem europäischen Nachbarland erfüllt möglicherweise die rechtlichen Vorgaben in Deutschland nicht. Um die Elektrik müssen Nutzer sich ebenfalls keine Sorgen machen, wenn sie eins beachten: „Wir raten, das Gerät ausschließlich steckerfertig zu kaufen“, sagt Jörg Sutter, Referent für Photovoltaik von der Verbraucherzentrale NRW. Zu vermeiden seien Angebote, die neben Solarpaneelen und Wechselrichter lediglich lose Kabel ohne die entsprechenden Steckvorrichtungen enthielten.
Das ändert sich mit dem neuen Gesetzesvorhaben
Bislang müssen Mieter das Einverständnis ihrer Vermieter und Eigentümer das Einverständnis der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) einholen – natürlich vor der Montage und Inbetriebnahme. Das könnte mit dem neuen Gesetz wegfallen. Außerdem wird die Anmeldung leichter: Derzeit müssen Verbraucher ihr Balkonkraftwerk nämlich sowohl beim Netzbetreiber anmelden – oft das lokale Stadtwerk – sowie in das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur eintragen. Kommt das neue Gesetz wie erwartet, entfällt die Anmeldung beim Netzbetreiber ab dem Jahr 2024.
Außerdem soll die Leistungsgrenze der Wechselrichter auf 800 Watt anstelle von aktuell 600 Watt steigen – ab dem Jahr 2024 dürften die Geräte also mehr Strom für den Haushalt bereitstellen als bisher. Auch das Verbot, Steckersolargeräte an analoge Stromzähler anzuschließen, könnte wegfallen. Diese sind besonders häufig in alten Häusern sowie auf dem Land verbaut. Dann müssten Nutzer vor der Installation keinen Stromzählerwechsel mehr abwarten.
Für wen lohnt sich ein Balkonkraftwerk?
Die Verbraucherzentralen raten zu ein bis zwei Standard-Solarpaneelen mit einer Leistung von maximal 400 Watt je Haushalt. Für einen Zwei-Personen-Haushalt empfehlen sie eine Mini-Anlage mit einem Modul, zwei Module rechneten sich nur, wenn der Grundverbrauch hoch ist. Ein Steckersolargerät mit einem Standardmodul kostet je nach Anbieter zwischen 350 und 600 Euro. Schon seit dem 1. Januar 2023 gilt für Steckersolargeräte eine Umsatzsteuersatz von null Prozent.
Wie viel Energie ein Haushalt mit einem Balkonkraftwerk sparen kann, hängt von dessen Lage sowie dem Haushaltsverbrauch ab. Laut einer Beispielrechnung der Verbraucherzentralen kann ein Balkonkraftwerk mit einem 400-Watt-Modul unter bestimmten Bedingungen an sonnigen Tagen nahezu die Grundlast eines Zwei-Personen-Haushaltes decken. Dazu sollte die Mini-Anlage beispielsweise an einem Balkon in Südlage, ohne Verschattung und senkrecht montiert sein. Das Steckersolargerät liefert in diesem Beispiel etwa 280 Kilowattstunden Strom pro Jahr.
Balkonkraftwerke speichern die erzeugte Energie allerdings nicht – und es gibt auch keine Einspeisevergütung für überschüssige Energie, die ins Netz fließt. Daher verringert sich der Stromverbrauch eines Haushaltes vermutlich nicht um die gesamte Kapazität der Anlage. Die Verbraucherzentrale geht in ihrem Rechenbeispiel von etwa 200 Kilowattstunden aus, um die sich der Stromverbrauch eines Haushaltes durch ein Balkonkraftwerk verringern kann. Bei einem Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde Strom beliefe sich die jährliche Ersparnis auf rund 70 Euro. Damit hätte sich die Anschaffungskosten nach fünf bis sieben Jahren amortisiert.
Ob sich das Balkonkraftwerk für die eigenen Gegebenheiten rentiert, können Interessierte einfach selbst ausrechnen. Der Stecker-Solar-Simulator der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) ermittelt, wie viel Strom und Geld Haushalte individuell mit einem Steckersolargerät einsparen können.
Laut Sutter ist die Frage nach der Rentabilität der Mini-Anlage für die meisten Menschen allerdings nicht der springende Punkt. Da Kosten und Aufwand für die Anlagen verhältnismäßig niedrig seien, überwiegen zumeist andere Argumente: „Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind neugierig auf die Technologie und wollen mit einem Balkonkraftwerk ihren Teil zur Energiewende beitragen“.