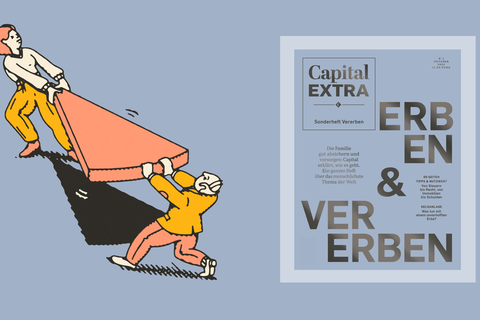Die Stimmung könnte kaum passender sein, um einen Blick in die Geschichte der Wirtschaftskrisen zu werfen: Düstere Wolken ziehen über den Frankfurter Himmel, eisig weht der Wind um das IG-Farben-Haus auf dem Campus Westend, der Blick aus dem Büro von Werner Plumpe fällt auf die kahlen Bäume vor den gewaltigen Bankentürmen. Krisen aus mehr als 700 Jahren hat der Wirtschaftshistoriker untersucht: die holländische Tulpenblase, den Südseeschwindel, die Weltwirtschaftskrise nach 1857, den Gründerkrach um 1873, den Schwarzen Freitag von 1929 – das entspannt. "Wenn wir einen Boom wollen", sagt er, "müssen wir die Kehrseite akzeptieren."
Die Furcht vor einem Systemzusammenbruch mag er nicht teilen. Verglichen mit Hungersnöten der vorindustriellen Ära seien heutige Finanzkrisen eher harmlos. "Bei der Kartoffelfäule in Irland starb in den 1840er-Jahren ein Drittel der Bevölkerung", sagt Plumpe. "Mit dem Kapitalismus sind aus existenzbedrohenden Krisen wiederkehrende Schwankungen geworden."
Viele Anleger sehen die Entwicklungen an den Finanzmärkten weniger gelassen: Seit dem Boomjahr 2001 haben sich Millionen Deutsche frustriert von Aktien abgewendet. Dotcom- und Immobilienblase, Finanz- und Euro-Krise – selten haben so viele Börsenabstürze in kaum mehr als einer Dekade die Nerven der Anleger strapaziert. Verängstigt legen sie ihr Geld seither auf niedrig verzinste Tages- und Festgeldkonten – und falls sie doch mutiger investieren, halten sie sich an Faustregeln.
Ein Fehler: Um Aktien, Immobilien und Gold ranken sich eine ganze Reihe von hartnäckigen Halbwahrheiten und Missverständnissen, die Anleger im schlimmsten Fall richtig Geld kosten können. Capital hat vier Weisheiten auf ihren Gehalt überprüft.
Aktien schützen vor Inflation
"Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Aktien bei Inflation schlecht abschneiden." Mit diesem Satz in einem Artikel des Wirtschaftsmagazins "Fortune" rüttelte Warren Buffett 1977 an einem Grundgesetz der Börse: Aktien sind verbriefte Anteile an Maschinen und Fabriken, also Sachwerte. Sie profitieren von Innovationen und Effizienzsteigerungen und schützen so vor Inflation.
Die Investorenlegende argumentierte, dass Renditen aus Aktienanlagen Kaufkraftverluste langfristig nicht ausglichen, da die Erträge nicht mit der Inflation stiegen. Buffett belegte sein Urteil mit statistischen Befunden: So seien in den Inflationsjahren 1965 bis 1975 die Erlöse der 500 umsatzstärksten US-Firmen real kaum gewachsen. Höhere Preise für ihre Produkte wurden von gestiegenen Kosten für Maschinen und Rohstoffe wettgemacht. Die Vermutung, die Renditen von Investitionen würden steigen, wenn nur der Kreditanteil der Finanzierung zunehme, erwies sich ebenfalls als falsch. Langfristig führe eine höhere Verschuldung zu einem schlechteren Rating und steigenden Zinsen. Dass Kredite billiger würden, sei unwahrscheinlich, da Gläubiger bei steigenden Preisen höhere Zinsen verlangten – erst recht, wenn das Zinsniveau steige.
Und schließlich zeigte Buffett, dass Firmen nicht in der Lage sind, die Inflation auf die Kunden abzuwälzen: Denn die Kosten für Arbeit, Rohstoffe und Energie würden in einer Inflation wohl kaum schrumpfen. So seien zwischen 1965 und 1975 die Margen im produzierenden Gewerbe gefallen.Buffetts Erkenntnisse stützt eine Langzeitstudie der Credit Suisse und der London School of Economics (LSE): Über 112 Jahre, von 1900 bis 2012, untersuchten Analysten den Zusammenhang zwischen realen Aktienerträgen und Inflationsraten in den 19 wichtigsten Industrieländern der Welt. Eine Regressionsanalyse ergab einen Korrelationskoeffizienten von minus 0,52 – was einen relativ starken Zusammenhang zwischen Inflation und sinkenden Aktienerträgen beweist.
Solange die Inflation moderat bleibt, halten sich die Einbußen bei der Wertentwicklung in Grenzen. Bei Werten von zwei Prozent ergeben sich laut den Analysten Renditen von rund zehn Prozent, bei einer Inflation von drei Prozent bleiben sieben Prozent übrig. "Langfristig war ein Investment in große Industriewerte sehr aussichtsreich", sagt Historiker Plumpe. "Wer in solche Werte investiert hat, konnte sein Vermögen sichern – trotz Inflation."Was die Studie von Credit Suisse und LSE aber auch zeigt: Steigt die Inflationsrate auf fünf Prozent und mehr, kippen die Renditen schnell. Inflationsschübe in den USA um das Jahr 1918, die frühen und späten 40er-Jahre und die Zeit zwischen 1970 und 1980 waren schlechte Aktienjahre (siehe Grafik). Als die Inflation zurückging, stiegen die Kurse wieder.
Wer Aktien kauft, wird moderate Inflationsraten übertreffen. In der Annahme einer Inflationswelle aber lohnt es, mit Aktienkäufen abzuwarten und Geld in inflationsindexierten Anleihen zu halten. Kommt die Inflation, schmilzt das Vermögen der Sparer, Konsumenten halten sich mit Käufen zurück, Unternehmen mit Investitionen, Firmengewinne brechen ein – die Aktienkurse fallen auf breiter Front. Erst danach bieten sich hervorragende Einstiegsmöglichkeiten.
Immobilien sind sicher
Häuser und Wohnungen sind der Deutschen liebste Anlage: Sie gelten als solide und versprechen verlässliche Erträge. Doch schützen sie auch vor Inflation? Dem Immobilienindex der Marktforschungsgesellschaft Bulwien Gesa zufolge gelingt das nicht immer.
Die Forscher haben den deutschen Immobilienmarkt seit 1975 untersucht und kamen zu dem verblüffenden Ergebnis: In den vergangenen 20 Jahren blieben die Miet- und Preissteigerungen bei Wohn- und Gewerbeimmobilien mit einem Plus von etwa einem Prozent pro Jahr meist hinter der Inflation zurück (siehe Grafik). Nur während des Wiedervereinigungsbooms und nach 2009 schlugen Immobilien die Inflation.
"Zwischen 1993 und 2004 lag der Immobilienmarkt in Deutschland fast brach", sagt Andreas Schulten, Vorstand bei Bulwien Gesa. Erst seit fünf Jahren gebe es einen Boom – doch der gelte vor allem für Wohnimmobilien und sei auf Großstädte beschränkt. "Viele übertragen die Wachstumsraten der Metropolen auf das ganze Land. Das ist ein Denkfehler." 2012 seien Mieten und Kaufpreise in begehrten Großstädten mit durchschnittlich 3,6 Prozent fast doppelt so stark gestiegen wie in Bochum oder Gelsenkirchen.
Dieses Phänomen lässt sich auch auf lange Sicht beobachten: Seit 1975 kommen München, Frankfurt und Heidelberg auf Wachstumsraten von durchschnittlich rund drei Prozent pro Jahr, während Bremen oder Saarbrücken unter zwei Prozent geblieben sind. Allerdings schwanke der Markt in den Großstädten stark, so Schulten: "2002 und 2003 sind selbst in München die Preise gefallen. Das haben einige schon vergessen."
Trennt man den Bulwien-Gesa-Index in Wohn- und Gewerbeimmobilien auf, zeigt sich: Wer auf Wohnhäuser setzte, fuhr in der Regel nicht schlecht. "Von 1975 bis 1993 waren deutsche Wohnimmobilien im Schnitt tatsächlich ein guter Inflationsschutz", sagt Schulten. In den 70er- und frühen 80er-Jahren zogen die Mieten und Preissteigerungen westdeutscher Immobilien mit der hohen Inflation mit: 1980 waren nominal fast acht Prozent drin. Durchschnittlich ergibt sich für die Jahre 1975 bis 1990 ein jährliches Plus von vier Prozent – eine nie wieder erreichte Rate.Langfristig hätten sich vor allem die A-Städte bewährt, sagt Schulten. Jetzt seien diese schon sehr teuer. "Interessant werden nun Studentenstädte wie Freiburg und Göttingen, die langfristig profitieren dürften."
Dass Immobilien auch für Zeiten existenzieller Krisen wie Hyperinflation oder Krieg eine exzellente Anlage sind, haben die Forscher jedoch widerlegt: Verglichen mit reinen Geldsparern kamen sie zwar meist glimpflich davon – schließlich blieben ihnen Häuser und Wohnungen erhalten. Die Renditen wurden jedoch zumeist im Nachhinein geschmälert – durch den Staat: Um Immobilienbesitzer an den Kosten des Ersten Weltkriegs zu beteiligen, erhob das Deutsche Reich von 1924 bis 1943 eine Hypothekengewinnsteuer: Sie traf alle, die Häuser und Wohnungen auf Kredit gekauft hatten und von der Inflation entschuldet wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg verteilte der Staat mit dem Lastenausgleichsgesetz erneut Geld an die Kriegsgeschädigten um. "Historisch betrachtet waren Immobilienanlagen nicht immer erfolgreich", urteilt denn auch Wirtschaftshistoriker Plumpe.
Wer Gold hat, hat immer Geld
Wie hoch war die jährliche reale Rendite von Gold seit Beginn des 19. Jahrhunderts? Fünf Prozent? Zehn Prozent? 20 Prozent? Die richtige Antwort lautet: nahe null Prozent. Von 1801 bis 2006, rechnet Jeremy Siegel, Professor für Finanzwissenschaft an der US-Universität Wharton, vor, seien aus 1 Dollar, der in Gold investiert wurde, inflationsbereinigt gerade einmal 1,95 Dollar geworden. Macht eine reale Rendite von weniger als 0,5 Prozent pro Jahr. Der Kauf eines breit gestreuten Aktienkorbs hätte 755 Dollar gebracht.
"In Finanzkrisen, in Zeiten von Inflation und großer Angst um den Bestand der Währung schneidet Gold gut ab", schreibt Siegel in seinem Bestseller "Stocks for the Long Run". "Doch wenn die Angst vorüber ist, verliert es an Wert." Er verweist auf die lange Schwächephase von Gold nach 1980: Damals, mitten in der zweiten Ölkrise, war Gold mit 850 Dollar je Unze schon einmal sehr teuer. Danach ging es bergab. Wer auf dem Höhepunkt ins Edelmetall einstieg, verdiente 26 Jahre lang keinen Cent. "Auch Gold ist keine risikolose Anlage", urteilt Wirtschaftshistoriker Plumpe. Für den Preis spiele Spekulation eine große Rolle.
Wie unberechenbar die Preisentwicklung ist, zeigen drei Phasen hoher Geldentwertung in Deutschland: Anfang der 70er-Jahre stieg der Goldpreis mit der Inflation: Die USA gaben damals die Kopplung des Dollar ans Gold auf, Anleger flüchteten weltweit ins Edelmetall. 1980 und 1981 verteuerte sich Gold hingegen nur zu Beginn der Inflationsphase, auf dem Höchststand fiel der Goldpreis. Im Wiedervereinigungsboom hielt die Entwicklung des Goldpreises ebenfalls nicht mit der allgemeinen Teuerung mit. Fazit: Eine Inflation in Deutschland muss nicht zwingend den globalen Goldpreis in die Höhe treiben.
Was Wharton-Professor Siegel nicht ahnen konnte: Seit 2006 hat sich der Goldpreis mehr als verdoppelt und die Inflationsrate deutlich abgehängt (siehe Grafik). Langfristig hat sich Gold als Inflationsschutz bewährt. Droht aber nun womöglich eine starke Kurskorrektur?
Da sind die Meinungen gespalten. Skeptiker halten den rasanten Anstieg für überzogen. Markus Mezger, Geschäftsführer von Tiberius Asset Management, etwa warnte vor einigen Monaten, der Goldpreis habe Extremszenarien wie das Ende des Euro schon eingepreist und eine gewaltige Inflation vorweggenommen. Blieben solche Szenarien nun aus, dürfte der Goldpreis fallen.
Die Mehrheit der Analysten rechnet indes damit, dass der Preis in diesem Jahr weiter steigt – auch wegen der niedrigen Zinsen. Der immanente Nachteil des Edelmetalls (es wirft keinen Kupon ab) fällt da nicht so schwer ins Gewicht. Selbst für den Fall, dass die extrem niedrigen Zinsen eines Tages wieder steigen, erwartet Thorsten Proettel keinen Goldcrash. Der Rohstoffanalyst der Landesbank Baden-Württemberg verweist auf die Inflation in den 70er-Jahren, als Anleger weltweit trotz steigender Leitzinsen ins Gold flüchteten. "Werden die Zinsen als Maßnahme gegen ein möglicherweise zu starkes Anziehen der Inflationsrate angehoben und die Inflationsängste bleiben weiter hoch", schreibt Proettel, "dann ist es sogar wahrscheinlicher, dass der Goldpreis hiervon profitiert."
Dividende sticht Kursfantasie
Witwen- und Waisenpapiere – so wurden Aktien von RWE und Eon lange geschmäht. Versorgeraktien galten gerade in starken Aktienphasen wie dem New-Economy-Boom um die Jahrtausendwende als Langweilerpapiere: Sie boten zwar verlässliche Ausschüttungen, ließen aber gegenüber Internetaktien die Fantasie von Kurssprüngen vermissen.
Langfristig erzielten Anleger, die auf dividendenstarke Aktien setzten, jedoch eine größere Rendite. Eine Untersuchung der US-Bank JP Morgan zeigt: Wer 1926 sein Geld an den globalen Börsen anlegte, verzeichnete inklusive Dividenden bis Ende 2011 ein jährliches Plus von 9,8 Prozent. Ohne Ausschüttungen waren es nur 5,2 Prozent. Wer auf Dividenden verzichtet, verschenkt Rendite.
Ähnliche Ergebnisse zeigt ein Blick auf den Verlauf des DAX mit und ohne Berücksichtigung von Dividenden seit 1987. Der Kursindex, der keine Ausschüttungen einbezieht, bleibt mit gut 4300 Punkten klar hinter dem DAX-Performance-Index mit knapp 8000 Punkten zurück. Während der Kursindex nach Capital-Berechnungen seit der Auflage um sechs Prozent jährlich zulegte, waren es mit Dividenden 8,6 Prozent. Wer 1987 10000 Euro investierte, verbuchte bis heute rund 43000 Euro ohne, aber 80000 Euro und somit fast doppelt so viel inklusive Dividenden.Die Stärke von Dividendentiteln zeigt auch eine Studie des Deutschen Instituts für Portfolio-Strategien. Die Forscher untersuchten, wie Firmen, die in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich ihre Dividende erhöhten, im Vergleich zum Gesamtmarkt abschnitten. Unter allen 527 Aktien aus dem regulierten Markt der Deutschen Börse fanden sie nur 14 solche Dividendenkönige, darunter der Baukonzern Bilfinger Berger, der Medizintechnikhersteller Fresenius und der Schmierstoffproduzent Fuchs Petrolub. Sie hängten mit einem Plus von 175 Prozent von 2008 bis 2012 alle deutschen Indizes locker ab.
Der Zinseszinseffekt von Dividenden schlägt umso stärker zu Buche, je länger der Betrachtungszeitraum gewählt wird. Forschern der Universität Princeton zufolge legten die Aktienkurse in den USA zwischen 1900 und 2000 ohne Berücksichtigung von Dividenden 5,4 Prozent pro Jahr zu. Wurden die Ausschüttungen hinzugerechnet, verdoppelte sich die Rendite beinahe auf 10,1.
Intuitiv liegt die Vermutung nahe, Dividenden trügen knapp 50 Prozent zum gesamten Anlageerfolg bei – weit gefehlt: Aus einem 1900 investierten Dollar wurden ohne Dividenden 198 Dollar und mit ihnen 16979 Dollar. Ganze 99 Prozent des Endvermögens stammten also allein von Dividenden, denn in Aktien wieder angelegte Ausschüttungen profitieren wiederum von Kursgewinnen und sind ihrerseits dividendenberechtigt.
Nur in einem Fall sollten Anleger aufhorchen: Wenn Firmen Dividenden dauerhaft aus der Reserve zahlen, müssen sie meist ihre Aktionäre über schlechte Ergebnisse hinwegtrösten. Ausgerechnet E.ON, ein vermeintlicher Liebling der Witwen und Waisen, zahlte 2012 die Dividende aus der Substanz – die einstige Langweileraktie zählt zu den Verlierern der Energiewende.