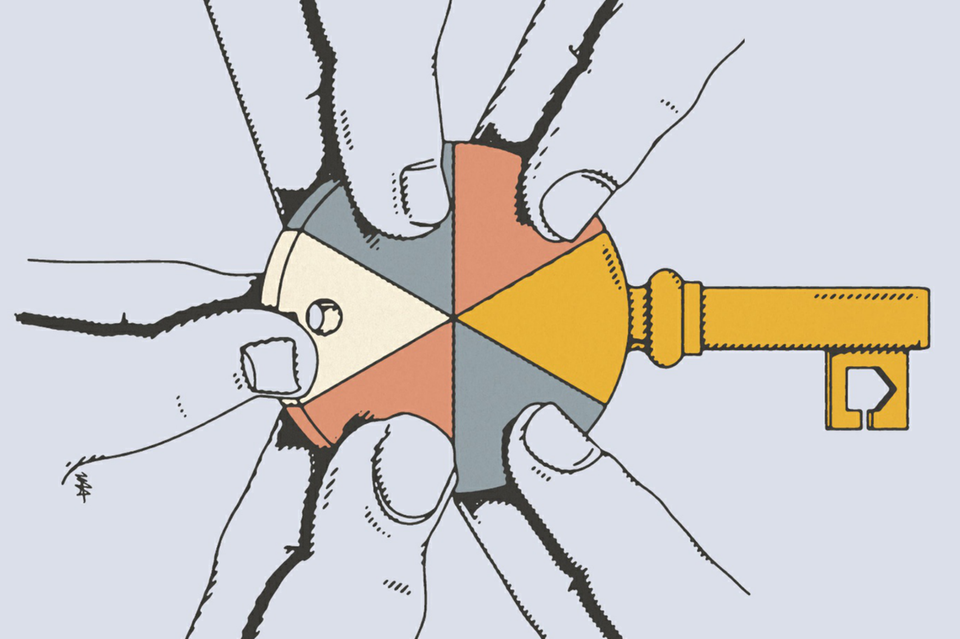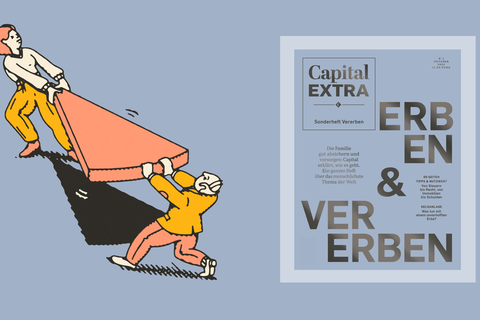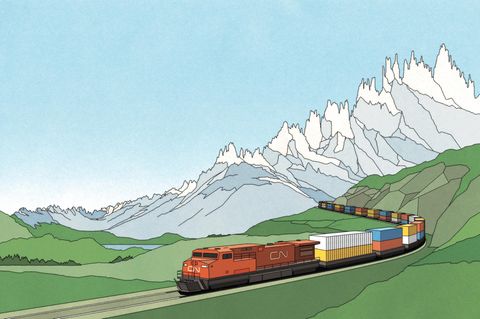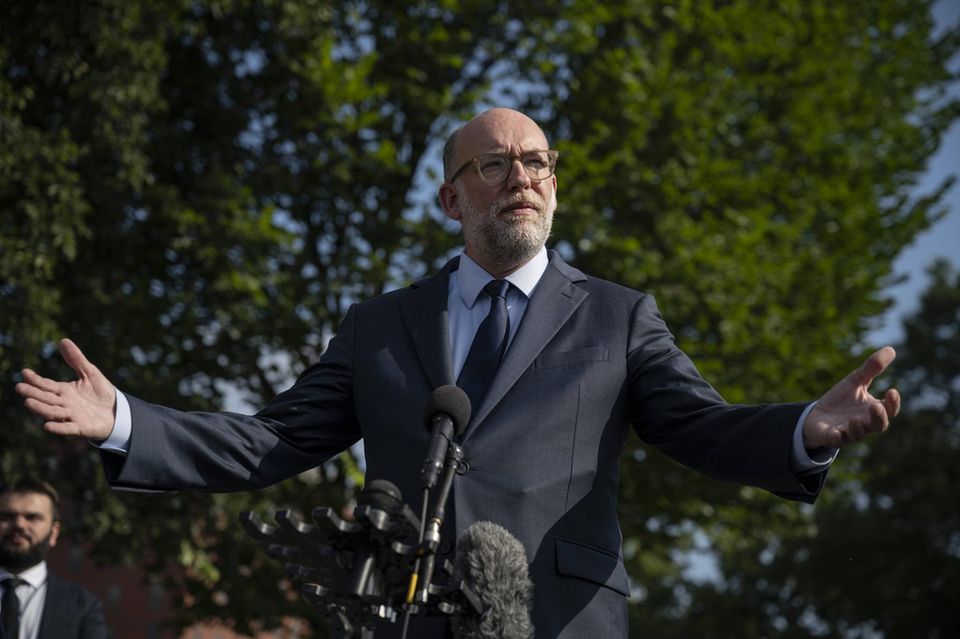Typischerweise gehen Investoren vor der Urlaubszeit keine übermäßigen Risiken ein. So auch in diesem Jahr, wie die monatliche Auswertung institutioneller Portfolios durch die US-Bank State Street zeigt. Die Anlage-Profis waren schon vor dem jüngsten Aktienmarktcrash neutral positioniert, scheuten also eine starke Positionierung in risikoreicheren Anlagen wie Aktien.
„Institutionelle Anleger ließen sich fast das ganze Jahr über nur schwer aus der Reserve locken“, sagt Timothy Graf, Leiter der Makrostrategie für die Region EMEA bei State Street Global Markets. „Auch der Juli bildete hier keine Ausnahme, denn unsere Maßgröße für die Risikobereitschaft lag im neutralen Bereich.“ State Street berechnet einmal monatlich auf Basis realer Portfolio-Bestände und -Transaktionen einen Risiko-Indikator, der für Juli genau bei null gelegen hat.
Neutrale Positionierung
Der Capital exklusiv vorliegende Risk Appetite Index (Index für Risikobereitschaft) ergibt sich aus der Messung der Anlegerströme in 22 verschiedenen Risikodimensionen in den Anlageklassen Aktien, Währungen, festverzinsliche Wertpapiere, rohstoffgebundene Anlagen und Asset Allocation Trends. Der Index erfasst den Anteil der 22 Risikoelemente, bei denen entweder risikofreudiges oder risikominderndes Verhalten festgestellt wurde. Ein positiver Wert bedeutet, dass die Anleger ihr Risiko insgesamt erhöhen, während ein negativer Wert einen Risikoabbau anzeigt.
Bemerkenswert ist also, dass der Crash am Aktienmarkt zu Wochenbeginn nicht aus einer Position hoher Risikobereitschaft von Investoren erfolgte. Sie waren vielmehr schon zurückhaltend investiert und haben dennoch in großem Stil mit Aktienverkäufen auf die Einengung der Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan reagiert. Man kann also mutmaßen, dass der Crash noch massiver ausgefallen wäre, wenn die Investoren nach stärker in Aktien investiert gewesen wären. Dann hätten sie vermutlich noch mehr „Risiko“ in ihren Depots abgebaut als sie es ohnehin taten – und die Aktienmärkte wären noch tiefer gefallen.
Der Schock der Yen-Aufwertung hätte ebenfalls stärker ausfallen können, wie die Daten von State Street andeuten. Denn Graf zufolge haben die Investoren bereits im Juli damit begonnen, ihre seit längerem bestehende Übergewichtung des Dollar abzubauen. Berichten zufolge hatten sich Investoren billig in Yen verschuldet und die Mittel höher rentierlich in Dollar-Anlagen investiert. Als die Zinsdifferenz zwischen beiden Währungen Ende vergangener Woche wegen steigender Zinsen in Japan und der Aussicht auf schnell sinkende US-Zinsen (als Reaktion auf Rezessionsängste) zusammenschnurrte, wurden viele dieser sogenannten Carry Trades aufgelöst und die Märkte brachen ein.
Verkauf europäischer Aktien
Zugleich reduzierten die Anlageprofis ihre Barmittelbestände im Juli und kauften sowohl Aktien als auch Anleihen zu. Die Ergebnisse werden aus institutionellen Anlagegeldern von 44 Billionen Dollar abgeleitet, die State Street verwahrt. Nicht berücksichtigt werden die von dem Unternehmen selbst gehaltenen Vermögenswerten von Investoren. Die Indikatoren messen das Vertrauen und die Risikobereitschaft der Anleger quantitativ, indem sie das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Anleger analysieren.
Konkret stieg bei den langfristigen Investoren der Anteil von Aktien um 37 Basispunkte auf 53,6 Prozent. In ähnlichem Umfang (43 Basispunkte) stieg die Allokation in festverzinsliche Wertpapiere auf 27,9 Prozent. Weil sie gleichzeitig in Aktien und Anleihen investieren, blieb die neutrale Gesamtpositionierung aber unverändert, erläutert Graf.
Von den Aktienkäufen profitierten die europäischen Märkte allerdings nicht. Im Gegenteil. „Die Anleger halten eine stark untergewichtete Positionierung im Euro – die stärkste unter allen wichtigen Währungen –, sind aber nicht gewillt, diese Untergewichtung abzubauen“, sagt Graf. „Hinzu kommt, dass internationale Anleger weiterhin Aktien aus dem Euroraum verkaufen.“