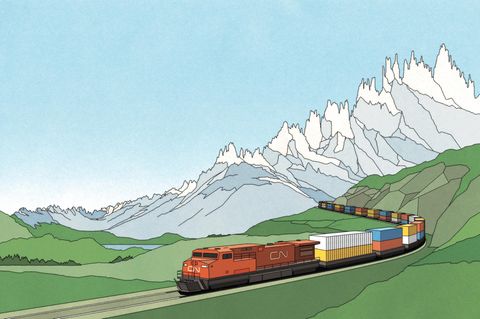Die vergangenen Wochen haben uns wieder einmal vor Augen geführt, wie sehr sich die Welt im Ausnahmezustand befindet. Humanitäre Katastrophen, politische Krisen und wirtschaftliche Unsicherheiten bestimmten die Schlagzeilen – und auch an den Börsen ging es turbulent zu. Vielleicht haben Sie selbst bemerkt, dass Sie auf diese Nachrichtenlage zunehmend gelassen, vielleicht sogar ein wenig abgestumpft reagieren? Dieses Phänomen hat einen Namen: Habituation.
Was steckt hinter Habituation?
Habituation beschreibt die Fähigkeit unseres Gehirns, sich an wiederkehrende Reize zu gewöhnen. Was uns beim ersten Mal noch erschüttert, verliert mit der Zeit an emotionaler Wucht. Psychologisch betrachtet ist das ein Schutzmechanismus: Er hilft uns, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und nicht von der ständigen Reizüberflutung überwältigt zu werden. Die Orientierungsreaktion schwächt sich ab – das Neue verliert seinen Schrecken, und wir nehmen es kaum noch bewusst wahr.
Börse und Gewöhnung: Zwischen Souveränität und Risiko
Gerade an den Finanzmärkten begegnen uns schlechte Nachrichten mit einer gewissen Regelmäßigkeit: Kurseinbrüche, geopolitische Krisen, Unternehmenspleiten. Viele Anlegerinnen erleben zu Beginn ihrer Investmentreise starke emotionale Reaktionen – von Sorge bis Panik. Doch mit jeder durchlebten Krise – sei es die Finanzkrise, die Corona-Pandemie oder politische Umbrüche – stellt sich eine gewisse emotionale Abhärtung ein. Diese Gelassenheit ist keineswegs negativ: Wer sich nicht von jeder Negativmeldung aus der Ruhe bringen lässt, trifft seltener impulsive und teure Fehlentscheidungen. Für langfristige Investorinnen, die auf Buy-and-Hold setzen, ist das ein echter Vorteil.
Doch Vorsicht: Die Kehrseite der Medaille ist, dass wir echte Risiken leicht unterschätzen, wenn wir uns zu sehr an schlechte Nachrichten gewöhnen. Warnsignale werden dann übersehen – etwa, wenn sich fundamentale Probleme in Unternehmen oder ganzen Branchen abzeichnen oder sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gravierend verschlechtern. Die Geschichte der Finanzmärkte zeigt, wie schmerzhaft solche Fehleinschätzungen sein können: Wer die Risiken der Finanzkrise 2007/08 oder der Corona-Pandemie unterschätzte, musste teils erhebliche Verluste verkraften. Auch die Zinswende 2022/23 kam für viele überraschend, weil die lange Phase der Nullzinspolitik zur Gewohnheit geworden war.
Wie bleiben wir wachsam?
- Selbstreflexion: Fragen Sie sich regelmäßig: Reagiere ich noch angemessen auf neue Informationen – oder bin ich bereits abgestumpft? Ein Tagebuch über eigene Gedanken und Anlageentscheidungen kann helfen, Muster zu erkennen.
- Diversifikation: Streuen Sie Ihre Anlagen breit über verschiedene Branchen, Regionen und Anlageklassen. So reduzieren Sie das Risiko, von einzelnen Entwicklungen überrascht zu werden.
- Regelmäßige Portfolio-Checks: Überprüfen Sie Ihr Depot mindestens einmal pro Jahr kritisch. Halten Sie Positionen nur aus Gewohnheit? Sind Ihre Investmentthesen noch aktuell?
- Externe Impulse: Holen Sie sich regelmäßig eine zweite Meinung – sei es durch unabhängige Finanzblogs, Podcasts oder Gespräche mit anderen Anlegerinnen. Außenstehende erkennen oft, was einem selbst entgeht.
- Wissen erweitern: Bleiben Sie informiert über wirtschaftliche und politische Entwicklungen. Wer Zusammenhänge versteht, kann Risiken besser einschätzen und bleibt handlungsfähig.
Habituation ist ein zweischneidiges Schwert: Sie schenkt uns an der Börse Ruhe und Souveränität, birgt aber auch die Gefahr, dass wir echte Risiken übersehen. Was uns emotional schützt, kann in gefährliche Gleichgültigkeit umschlagen – nicht nur gegenüber den Märkten, sondern auch angesichts der Krisen und Konflikte dieser Welt. Bewusste Selbstreflexion und regelmäßige Überprüfung der eigenen Haltung sind daher unerlässlich. Die wichtigste Investition bleibt: ein wacher, mitfühlender Verstand.