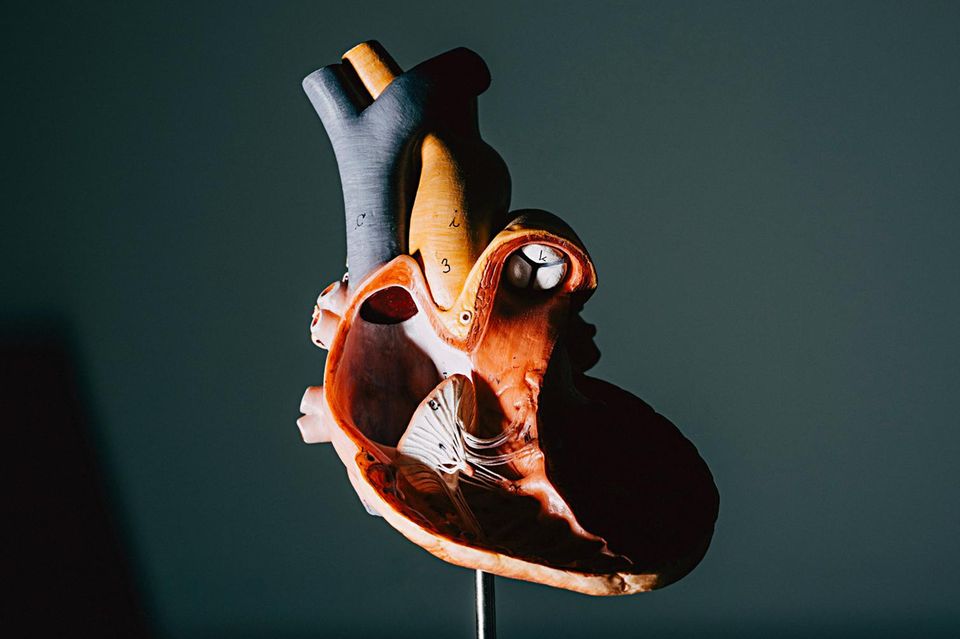Ist die Zunahme der Pflegefälle wirklich so dramatisch und überraschend, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach es darstellt?
JÜRGEN WASEM: Dazu muss ich kurz ausholen: Bei der Pflegereform 2016 wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt. Seitdem ist es erstmals so, dass man auch mit Demenz und kognitiven Beeinträchtigungen pflegebedürftig im Sinne der Pflegeversicherung werden und Leistungen bekommen kann. Vorher war es so, dass nur als pflegebedürftig galt, wer körperlich hinfällig war. Bei Einführung dieses neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs hat man versucht abzuschätzen, wie viele zusätzliche Fälle dadurch hinzukommen. Und dabei lag man bisher jedes Jahr weit daneben. Insgesamt haben wir jetzt eine Million mehr zusätzliche Fälle, als man gedacht hatte. Und insofern fügt sich diese Zahl für das vergangene Jahr in ein Bild ein, das wir die letzten Jahre auch immer schon hatten: Ein Plus von 50.000 Fällen war geschätzt worden, 360.000 sind es geworden.
Überraschend ist diese Zahl also nicht.
Es hat bisher jedes Jahr seit 2017 wieder überrascht, dass wir mehr zusätzliche Pflegefälle haben, als wir das geschätzt hatten. An so eine Überraschung kann man sich auch gewöhnen.
Wie ist diese fortdauernde Fehleinschätzung zu erklären?
Vermutlich ist nach wie vor der Punkt, dass wir eine ganz neue Gruppe haben, die potenziell die Pflegeversicherung in Anspruch nimmt: Leute mit kognitiven Beeinträchtigungen. Und das waren in den letzten Jahren immer mehr, als wir geschätzt haben. Ich vermute, dass dies auch im letzten Jahr wieder der Grund war. Es dauert offenbar, bis das bei den Ärzten und bei den Familien überall angekommen ist, dass es diese neue Regelung gibt.
Was ist mit diesem „Sandwich-Effekt“, den Lauterbach als möglichen Grund für den Anstieg der Fälle nennt?
Damit meint Lauterbach: Nun sind auch die Babyboomer in der Pflegebedürftigkeit angekommen. Die und ihre Elterngeneration sind gleichzeitig pflegebedürftig und stellen dieses Sandwich dar. Ich habe ihn zumindest so verstanden, dass er denkt, dieser Effekt erkläre den hohen Anstieg der Fallzahlen. Ich halte das aber für sehr unwahrscheinlich. Die Boomer sind jetzt bestenfalls Anfang 70, die meisten sind noch Ende 60. Da ist die Pflegebedürftigkeitsquote noch sehr gering. Die steigt ab Ende 70, Anfang 80 deutlich an.
„Demenz ist schambehaftet“
Wenn die Schätzung jahrelang so falschliegt, schreit das doch geradezu nach einer neuen Prognose?
So einfach kann man das nicht beheben. Aber ich gehe davon aus, dass sich dieser Effekt wegen des neuen Begriffs dann so in ein, zwei Jahren ausgelaufen hat. Aber sozusagen belastbare Daten dazu gibt es nicht.
Warum ist dieser Effekt so schwierig einzuschätzen?
Offensichtlich ist es so, dass die Betroffenen und ihre Angehörigen in Befragungen Probleme wie Demenz und kognitive Einschränkungen nicht gerne angeben. Das ist mit Scham besetzt. Aber jetzt, wo es nun Leistungen gibt, kommt man den realen Zahlen näher. Wobei ich auf keinen Fall den Eindruck erwecken möchte, dass sich Leute Ansprüche erschleichen. Die Ärzte des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen berichten nach wie vor, dass Betroffene eher versuchen, kompetenter zu erscheinen, als sie in Wahrheit sind, weil Demenz eben schambehaftet ist.
Was bedeutet dieser Fallanstieg für die Finanzierung der Pflegeversicherung?
Man weiß noch nicht alles über diese gut 300.000 zusätzlichen Pflegebedürftigen, was man wissen müsste. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass die alle ambulant gepflegt werden und dass sie so viel kosten, wie ein durchschnittlicher ambulanter Pflegefall, dann bedeutet das rund 2,8 Mrd. Euro zusätzliche Kosten. Wenn Sie das in Beiträge der Pflegeversicherung umrechnen, wären das 0,16 Beitragssatzpunkte. Die käme also zum aktuellen Beitragssatz zur Pflegeversicherung von durchschnittlich 3,5 Prozent dazu.
0,16 Prozentpunkte hört sich jetzt noch nicht so dramatisch an. Aber mittelfristig würde das wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Pflegeversicherung zu finanzieren, oder?
Wir stehen erst am Beginn der Alterung der Bevölkerung. Die demografische Entwicklung schlägt bei der Pflegeversicherung erst langsam, dann aber umso stärker zu. Das liegt an der extremen Altersabhängigkeit der Pflegequoten: Bei den 70-Jährigen sind es vier bis fünf Prozent, die pflegebedürftig sind, bei den 85-Jährigen sind es 35 Prozent und bei den 95-Jährigen sind es 80 Prozent. In 20 Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge also Mitte 80 bis Anfang 90 sein. Denen stehen auch viel weniger Erwerbstätige gegenüber.
Mehrere Finanzierungsmöglichkeiten
Wie können wir uns darauf vorbereiten?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zunächst müssen wir entscheiden, ob wir mehr bezahlen oder die Versorgung verschlechtern wollen. Man kann natürlich sagen, wir wollen das nicht finanzieren, die Lohnnebenkosten für die Arbeitnehmer würden zu stark steigen. Das hieße, den Personalschlüssel in den Pflegeheimen zu verschlechtern, Sozialleistungen abzubauen. Wenn wir das nicht wollen, dann muss man den zusätzlichen Bedarf finanzieren. Dafür gibt es wieder mehrere Möglichkeiten.
Welche Möglichkeiten sind das?
Die erste Option ist: Wenn wir nichts ändern am System, steigen einfach die Beitragssätze. Die zweite Möglichkeit: Wir holen mehr Steuergeld dazu. Das ist natürlich auch eine Belastung der künftigen Arbeitnehmer. Als weitere Möglichkeit kann man auch über eine Bürgerversicherung die bislang privat Versicherten stärker belasten. Das kann man aus Gerechtigkeitsgründen wollen, bringt finanziell aber nicht viel. Die vierte Möglichkeit ist, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, dass die meisten Babyboomer eben noch 20 Jahre von der Pflegebedürftigkeit entfernt sind, und mithilfe privater Zusatzvorsorge mehr anzusparen. Da die Boomer jetzt am Ende ihrer Erwerbsbiografie relativ hohe Einkommen haben, würden sie noch mal spürbar mit beitragen zum Aufbau einer kapitalgedeckten Säule der Pflegeversicherung. Das würde in 20 Jahren die Beitragsentwicklung stärker von der Alterung abkoppeln. Aber diese Option hat einen Schönheitsfehler: Denn das hieße, dass für die Beitragszahler in den kommenden Jahren zusätzlich zu den ohnehin anstehenden Beitragserhöhungen noch das Ansparen für die Zukunft als Doppelbelastung dazu käme.
Wie optimistisch sind Sie als Ökonom, dass wir die Pflege angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland mittelfristig ausreichend finanzieren können?
Es kommt auch noch etwas hinzu, was wir noch gar nicht besprochen haben: Es wächst natürlich auch der Personalbedarf. Das heißt, die Pflege, die jetzt schon unter Personalmangel leidet, muss attraktiver werden, also die Pflegekräfte tendenziell besser bezahlen. Das wird eine Kraftanstrengung für die Gesellschaft! Solange unsere Wirtschaft halbwegs vernünftig wächst, kriegen wir das hin, glaube ich. 1970 lag der durchschnittliche Beitragssatz der Krankenkassen bei acht Prozent, jetzt liegt er bei 16 Prozent. Der durchschnittliche Beitragssatz hat sich also in 50 Jahren verdoppelt. Das war tragbar, weil wir eine wachsende Wirtschaft hatten. Wenn die Wirtschaft weiterwächst, bin ich auch optimistisch. Richtig schwierig wird es in einer stagnierenden Wirtschaft.
Das Interview ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zur RTL Deutschland.