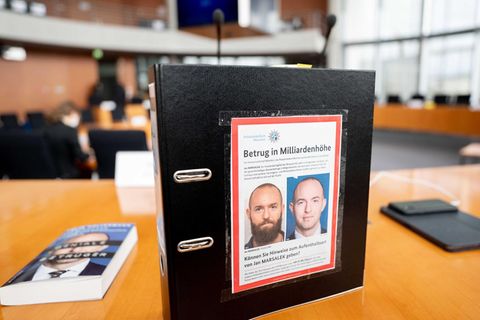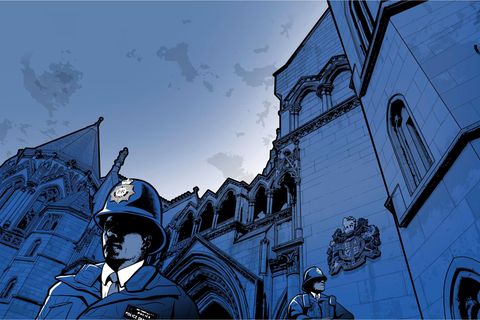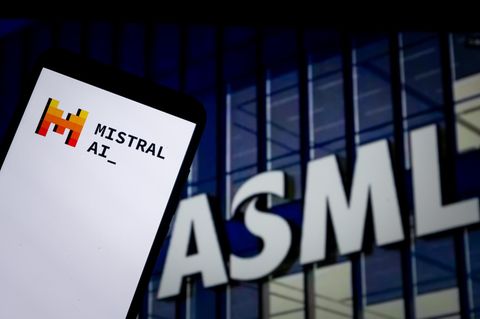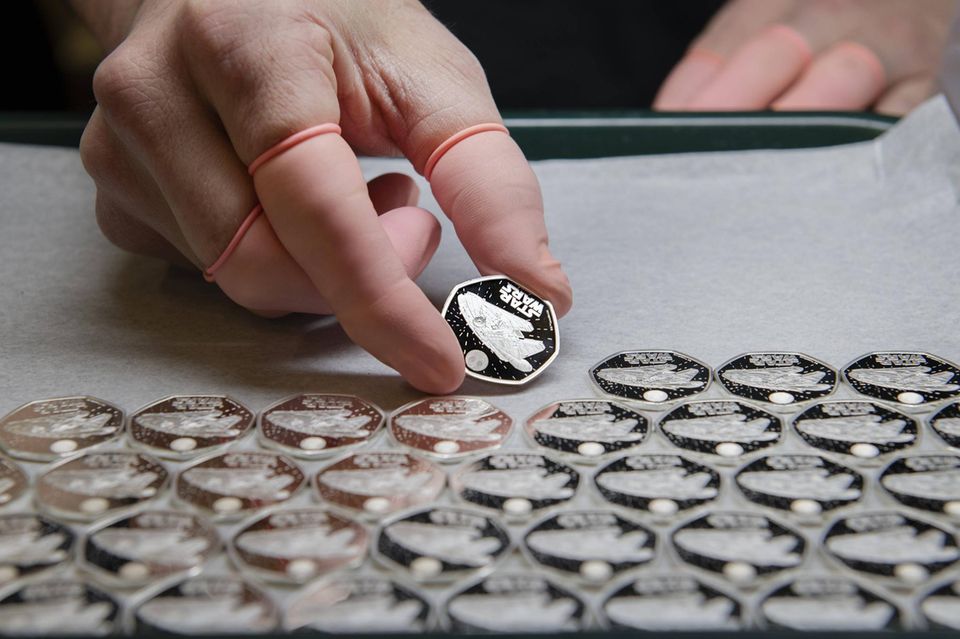Die Pinzetten liegen in der Schublade wie Juwelen: Auf blauem Samt gebettet, glänzen sie, fein säuberlich sortiert – „chirurgische Pinzetten“ für den Einsatz im OP, geschwungen, gerade, lang oder kurz. Mit ihnen werde Gewebe entfernt, erklärt Simone Tolk, dann zieht sie die nächste Schublade auf. Darin liegen „anatomische Pinzetten“. Ihnen fehlen die spitzen Zähne an den Greifbacken. „Ärzte verwenden sie, wenn sie bei der OP in der Nähe von Nerven- oder Blutbahnen operieren“, sagt Tolk.
Die 47-Jährige ist in ihrem Element. Ihr Reich umfasst Hunderte Schubladen und Schaukästen, gefüllt mit Präparierscheren, Hämorrhoidenklemmen, Knochenzangen, Wundspreizern. Manche besitzen seltsame Schaufeln, sind bizarr verdreht oder gefährlich spitz – man staunt und erschaudert zugleich bei der Vorstellung, wie damit am Herzen oder Magen operiert wird. Für jedes Organ, jedes Körperteil gibt es hier spezielle Instrumente, erklärt Tolk. Rund 30.000 sind es im Moment, mitgezählt all die Implantate für Knie, Wirbelsäule, Hüfte, die sie auch zur Schau stellen.
Das Besucherzentrum von Aesculap in Tuttlingen ist die wohl größte Werkzeugkammer für Ärzte in Deutschland, wenn nicht in der Welt. Die Stimmung ist ruhig, gedämpft wie bei einem Juwelier. Wer hierherkommt, ist häufig Chefarzt oder Einkäufer eines Krankenhauses – und gibt in der Regel eine Menge Geld aus. Die Kunden stammen aus aller Welt, China, Dubai, der Schweiz. Natürlich gäbe es vieles auch online zu bestellen, aber die allermeisten operierenden Ärzte reisen an, um sich ihr Besteck, wie es im Fachjargon heißt, vor Ort zusammenzustellen. Vom „Toys’R’Us für Mediziner“ spricht Tolk. „Das ist wie bei einem Füller, den müssen Sie erst in der Hand halten, um zu wissen, ob er passt“, sagt sie. Seit 30 Jahren ist Tolk bei Aesculap, seit zehn Jahren leitet sie die Abteilung Planung und Beratung.
Tolks halbe Familie arbeitet bei dem Medizininstrumentenhersteller – und das ist nichts Ungewöhnliches hier. Tuttlingen an der Donau, auf halber Strecke zwischen Zürich und Stuttgart, lebt nach wie vor prächtig vom Geschäft mit chirurgischen Instrumenten. Die Kreisstadt rühmt sich selbst als das „Weltzentrum der Medizintechnik“, 400 bis 600 Firmen sitzen hier, ganz genau weiß das keiner. Die allermeisten haben kleine Betriebe mit 10, 20 Mitarbeitern, es gibt eine Handvoll mittelgroßer – und die beiden Vorzeigeunternehmen Aesculap und Karl Storz mit ein paar Tausend Beschäftigten. Es ist ein Nebeneinander von Handwerk und Hightech, Tradition und Moderne.
Von den rund 35.000 Tuttlingern schafft jeder dritte in der Medizintechnik. Die Stadt und ihr Cluster gehören zu den industriestärksten im ohnehin wirtschaftsstarken Baden-Württemberg. Vollbeschäftigung, zwei Prozent Arbeitslose, die Unternehmen investieren viel, die Stadt nimmt dreimal so viel Steuern ein wie andere Städte vergleichbarer Größe. Und geschafft, das ist das Besondere, hat Tuttlingen das Wirtschaftswunder ganz ohne Masterplan, Landesväter und Fördergelder – vor allem aus eigener Kraft.
Aschenputtel
Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als ideal. Hier am Südende der Schwäbischen Alb gab es keine Kohle, kaum Erz und lange keine Eisenbahn. Die Erträge in der Landwirtschaft waren karg, die weltliche und geistliche Obrigkeit hielt nicht viel von technischem Fortschritt. Und so wanderten die Menschen noch bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts am liebsten aus.
Die abgelegene Region war das „industrielle Aschenputtel Württembergs“, schreiben Michael Unge-thüm, der langjährige Aesculap-Chef, und der Archivar Wolfgang Kramer in ihrer Geschichte der Tuttlinger Medizintechnik. Dass die Region sich binnen wenigen Generationen in die „Stadt der heilenden Messer“ verwandelte, habe sie „vor allem tüchtigen, kleinen, unternehmungslustigen, tatkräftigen Leuten“ zu verdanken.
Die widrigen Umstände, mutmaßen die Autoren, hätten am Ende zusätzliche Kräfte mobilisiert. Hinzu kam ein calvinistisches Arbeitsethos, ein schwäbisches „Schaffe, schaffe“, das bis heute lebendig ist – und dazu die Dynamik, die jeder Cluster irgendwann entwickelt: Unternehmen schaffen sich ihre eigene Infrastruktur; vorhandenes Fachwissen zieht weitere Spezialisten an; Angestellte verlassen ihre Arbeitgeber, um auf der Wiese nebenan eigene Unternehmen zu gründen – so ist auch dieser Cluster aus sich selbst heraus gewachsen. Mittlerweile gibt es sogar eine Hochschule, der Campus Tuttlingen bildet seit 2009 Ingenieure aus. Für Studiendekan Kurt Greinwald „ein Riesenerfolg“. Seit die Unternehmen sich gemeinsam für ihre Hochschule engagieren, „ist ihr Misstrauen untereinander gesunken, der Austausch funktioniert viel offener“. Außerdem zögen die jungen Leute nun nicht mehr alle weg.
Begonnen aber hat alles mit ihm: Gottfried Jetter, dem Gründer der späteren Aesculap AG. Sein Vater noch war ein armer Strumpfweber, der Sohn lernte erst Messerschmied, ging dann auf Wanderschaft, kehrte 1867 zurück und eröffnete eine winzige Werkstatt: zwei Drehbänke, Stanze, Schraubstock und Amboss, eine Handvoll Mitarbeiter. Zu der Zeit gab es 177 Messerschmiede in Tuttlingen und fünf Fabriken, denn in der Nähe der Stadt hatte sich dann doch noch ein Hüttenwerk angesiedelt. Weil der Messerabsatz aber sank, beschloss Jetter, Instrumente für die Medizin herzustellen. Ihm half der medizinische Fortschritt: Chloroform machte Narkose möglich und erlaubte Ärzten neue Operationen. Die aber verlangten auch neue Medizininstrumente.
Welch rasanten Aufstieg das Unternehmen nahm, sieht der Zugreisende heute noch. Gleich dem Bahnhof gegenüber thront ein riesiges Backsteingebäude mit Giebeln und Erkern. 1899 ließ Jetter das „Tuttlinger Schloss“ bauen, bis heute hat Aesculap hier seine Firmenzentrale. Ringsherum dehnt sich ein imposantes Werksgelände mit zwei Dutzend Gebäuden, vor dem Schloss liegt ein riesiger Kreisverkehr, der Aesculap-Platz – finanziert haben ihn Stadt und Unternehmen gemeinsam. Selbst der Bahnhof, den sie hier demnächst aufmöbeln wollen, gehört zur Hälfte dem Unternehmen.
Joachim Schulz ist seit April Vorstandschef von Aesculap, das mittlerweile zu B. Braun Melsungen gehört, einem führenden Systemanbieter im Gesundheitsbereich. Der Wuppertaler, seit Ende der 80er-Jahre im Konzern, muss das Unternehmen in eine neue Zeit führen. Denn natürlich können sie hier nicht mehr davon leben, die immer gleichen Scheren zu machen. „Die Trends heißen Minimalisierung, Biologisierung, Digitalisierung“, sagt Schulz. Medizin ist längst ein komplexes System verschiedener Technologien.
Die Biologisierung bei Implantaten etwa ist eins von Katrin Sternbergs Fachgebieten. Was das ist, zeigt sie in einem ihrer vielen Labore. Zum Beispiel besprühen die Forscher, vereinfacht gesagt, Implantate mit einer Schicht, die den Körper schützt und später abgebaut werden kann. Eine Nische für Aesculap, ein großer Fortschritt für die Menschheit, denn oft reagieren Patienten allergisch auf Prothesen aus Nickel, Kobalt oder Chrom.
Sternberg, begleitet von einem Tross Männern in weißen Kitteln, führt in den nächsten Raum, wo die Beschichtungen getestet werden: In ein halbes Dutzend Apparaturen sind Hüftprothesen eingespannt. Jedes Gerät imitiert eine andere menschliche Bewegung, strecken, beugen, springen. Tag und Nacht laufen die Foltermaschinen, zehn Wochen lang, dann wissen sie, wie gut die Versiegelung hält. Geforscht wird hier aber auch seit fast zehn Jahren an Bioimplantaten, etwa daran, Knorpel aus menschlichen Knorpel- oder Stammzellen zu züchten. Beim Schaf funktioniert das gut, beim Menschen läuft die klinische Erprobung erfolgreich.
Für einen Forscher sei Tuttlingen ein Traum, sagt Sternberg. Vor drei Jahren kam die Chemikerin aus Rostock: „Die Stadt mit ihrer geballten Medizintechnikkompetenz hat einen unheimlichen Reiz auf mich ausgeübt.“ Hier könne sie ihre Forschung in ein Produkt verwandeln. Karriere hat die ehemalige Professorin für Medizintechnik schnell gemacht, seit Kurzem leitet sie die Aesculap-Forschung mit 350 Mitarbeitern.
Schlüssellochmedizin
Vom erstaunlichen Fortschritt der Medizintechnik und dem Tüftlergeschick eines Einzelnen handelt auch die Geschichte des anderen großen Instrumentenherstellers im Ort: der Firma Karl Storz. Auch nach ihr ist eine Straße benannt und demnächst auch ein Kreisverkehr samt Weltkugel. In dieser Stadt, so scheint es, wetteifern die beiden Großen regelrecht darum, sich Denkmäler zu setzen. Wer durch die Innenstadt läuft, stößt allerorten auf gesponserte Skulpturen und Springbrunnen.
Karl Storz, ein gelernter Instrumentenmacher, gründete 1945 in Tuttlingen seinen Betrieb, stellte erst Stirnlampen und Werkzeug für HNO-Ärzte her, bevor er sieben Jahre später ein Instrument auf den Markt brachte, das die Chirurgie revolutionieren sollte: das Endoskop. Mit ihm konnten Ärzte den Körper des Menschen von innen betrachten und bald auch operieren. Es war der Beginn der Schlüssellochmedizin mit kleineren Schnitten, kürzeren Eingriffen, weniger Schmerzen und besserem Heilungsverlauf.
Geführt wird das Unternehmen seit dem Tod des Gründers 1996 von seiner Tochter Sybill Storz, einer energischen Dame, die im Juni 80 wird, dem Alter trotzt und fast täglich im Büro sitzt. Gerade ist sie mit ihrem Sohn auf Geschäftsreise in Neuseeland und Australien. In Tuttlingen wird sie hoch geschätzt, aber auch ein wenig gefürchtet. Selbst der erste Bürgermeister erzählt nur halb im Scherz, dass er sich immer erst umzieht, wenn er zu „Frau Dr. Storz“ hinüberfährt. Sie selbst wirkt am Telefon wenig furchteinflößend, sie macht nur rasch klar, dass sie nicht vorhat, über Gewinne oder Margen einzelner Geschäftsbereiche zu sprechen. Karl Storz ist Family-Business. Nur so viel: Seit sie Chefin ist, habe sie den Umsatz mehr als verdoppelt, 1,4 Mrd. Euro waren es zuletzt. 2000 Mitarbeiter hat Storz vor Ort, investiert hat sie kürzlich Millionen in ein Logistikwerk. Ihren Erfolg erklärt sie auch damit, dass sie es als Frau immer schwer gehabt habe in Tuttlingen und es allen beweisen wollte.
Was Karl Storz kann, zeigt das Unternehmen im Besucherzentrum: Vier voll eingerichtete OP-Säle samt Aufwach- und Vorbereitungsraum haben sie am Standort aufgebaut. Der Operateur blickt auf ein dreidimensionales, messerscharfes Bild auf einem Triptychon aus Flachbildschirmen. Per Touchscreen kann der Arzt die Bilder des Endoskops steuern oder die Beleuchtung ändern. Es gibt selbst ein Operations-Navi: Der Alarm piept, wenn der Chirurg in gefährlicher Nähe empfindlicher Körperteile hantiert.
Die Technik aber bedeutet Aufwand: Richtet eine Klinik heutzutage einen OP neu ein, dann rücken Statiker, Elektriker und Klimaanlagenbauer gleich mit an, erklärt Hans-Uwe Hilzinger, eine Art OP-Einrichtungsberater. Es braucht meterweise Kabel, die Decke muss Tonnen halten, da an ihr riesige Greifarme mit Technik hängen – es sieht mehr nach Raumstation aus als nach OP.
Handarbeit
Dabei muss es gar nicht immer digitales Hightech sein in Tuttlingen. Das Erste etwa, was Rafael Jakubik voller Stolz zeigt, sind seine Hände: voller Schwielen und Dreck. „Bei uns machen sich die Chefs noch schmutzig“, sagt er. Jakubik spricht laut, auch wenn die Maschinen gar nicht laufen. Die Gewohnheit. Schweißen, schleifen, härten, polieren – der 39-Jährige ist Chirurgiemechaniker und ein Meister seines Fachs.
Zusammen mit Van Nhi Hoang, der als Kind aus Vietnam hier strandete, gründete er 2004 JaHo Medizintechnik. In ihrer Werkstatt fertigen sie in Handarbeit Spezialscheren aller Art, für die Herz- und Augenchirurgie, den Damm- oder Lungenschnitt. Unter den kleineren Unternehmen Tuttlingens sind solche wie JaHo typisch. Bei den beiden Gründern reifte der Plan zur Spezialisierung in der gemeinsamen Lehre. Vier feste Mitarbeiter haben sie heute, ein paar Aushilfen – und ein Problem.
Bei JaHo laufen die Geschäfte gut, Aufträge haben sie reichlich, der Arbeitstag, sagen die Gründer, gehe oft von 5 bis 19 Uhr. Samstags sind sie fast immer da, Jakubiks Frau macht sonntags „Büro“. Beide Gründer haben ihr Wohnhaus gleich neben die Werkstatt gebaut.