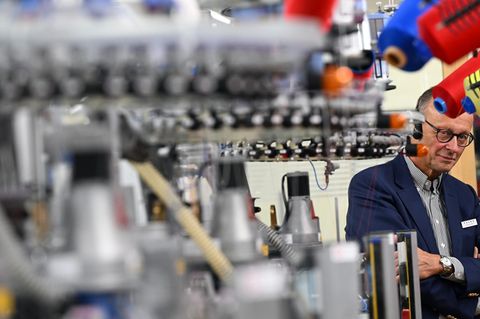Der erste Aufreger dieses ohnehin außergewöhnlichen Wahlkampfs ging am 8. November um 13.17 Uhr im Bundeskanzleramt ein. Eine Mail – abgesendet von einem Mitarbeiter der Bundeswahlleiterin. Betreff des Schreibens im Anhang, das direkt an den Bundeskanzler gerichtet ist: „Herausforderungen und Risiken einer vorgezogenen Neuwahl im Januar beziehungsweise Februar 2025“.
Zwei Tage nach dem Ampel-Aus führt Ruth Brand, die Bundeswahlleiterin, in dem Schreiben aus, welche „unwägbaren Risiken“ aus ihrer Sicht im Fall einer zügigen Neuwahl bestehen: bei der Bereitstellung der nötigen IT, der Aufstellung der Kandidatenlisten, ja sogar bei der Beschaffung des Papiers und der Vergabe der Druckaufträge für die Wahlunterlagen. Es bestehe eine „hohe Gefahr“, dass durch eine kurze Vorbereitungszeit „der Grundpfeiler der Demokratie und das Vertrauen in die Integrität der Wahl verletzt werden könnte“, warnt die Wahlleiterin.
Der Brand-Brief platzt mitten hinein in einen hitzigen Streit um den Wahltermin, den die Lager von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seines CDU-Herausforderers Friedrich Merz unmittelbar nach dem Ampelcrash angezettelt hatten. Merz und die Union drangen darauf, dass Scholz zügig die Vertrauensfrage im Bundestag stellt, um den Weg für eine schnelle Neuwahl frei zu machen. Ihr Kalkül: Die Wähler sollten das Wort haben, solange das Ampelchaos noch frisch ist, um die guten Umfragewerte für die Union ins Ziel zu bringen. Dagegen bremsten Scholz und die SPD, wohl weil sie auf mehr Zeit hofften, aus ihrem Umfragetief heraus ein Comeback zu schaffen. Und auf mehr Zeit für Merz, große Fehler zu machen und seinen Vorsprung zu verspielen – so wie es 2021 der damalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet tat.
Es ging also beim Wahltermin diesmal um weit mehr als eine Formalität – sondern um einen wichtigen Vorteil in diesem besonderen Winterwahlkampf.