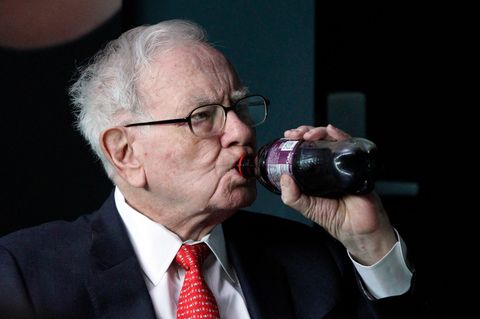Für die aktuelle Entwicklung an den Aktien- und Anleihenmärkten weltweit hat die New York Times eine ebenso einfache wie treffende Formulierung gefunden: Der „Alles“-Boom“. Denn egal ob seit Jahresbeginn oder über ein oder drei Jahre: Fast alle Wertpapiere haben Anlegern hohe Renditen beschert (eine sortierbare weltweite Übersicht dazu hier).
Und sollte jemand Zweifel an der Haltbarkeit des „Alles-Booms“ bekommen haben oder gar auf fallende Kurse gesetzt haben, so haben ihn die Entwicklungen der vergangenen Tage Lügen gestraft: Weder besorgniserregende Zahlen zur konjunkturellen Lage in Europa (hier eine Einschätzung dazu) noch die Turbulenzen der portugiesischen Bank Espirito Santo noch die grauenvolle Entwicklung im israelisch-palästinensischen Konflikt oder in der Ukraine hat zu wirklich nachhaltigen Kursrückschlägen geführt.
Im Gegenteil: Die Aktien- und Anleihenmärkte befinden sich in einem Modus, in dem jede Nachricht – egal ob gut oder schlecht – positiv umgedeutet wird, als hätten die Akteure jeden Morgen eine Familienpackung Prozac vertilgt. Es gibt gute Konjunkturdaten? Vorzüglich: Dann klettern die Unternehmensgewinne künftig und sinken die Ausfallrisiken am Anleihenmarkt – und alle Kurse steigen. Es gibt schlechte Konjunkturdaten? Auch gut. Dann kaufen die Notenbanken gewiss weiter Anleihen, halten so die Anleihekurse hoch (und die Zinsen niedrig) und machen Aktien noch attraktiver – und die Kurse steigen. Es lag noch Rauch über den Trümmern der abgeschossenen Boeing 777 der Malaysia Airline, als am späten Donnerstag eine Einschätzung die Runde machte, der Zwischenfall könnte der Katalysator für das Ende des Konflikts sein.
Wer will schon der Trottel sein?
Wer in diesem merkwürdigen Spiel dabei ist, freut sich zwar, bekommt aber Woche für Woche ein immer mulmigeres Gefühl im Bauch, wie lange das noch gut gehen wird. Und wer an der Seitenlinie steht, fühlt sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass wir nicht nur einen „Alles“-Boom, sondern auch eine „Alles“-Blase sehen, die bald platzen wird.
Es ist jener „Alles-Boom“, der auch entscheidend dazu beiträgt, dass in Deutschland der Netto-Vermögensaufbau seit Jahren fast ausschließlich über Bargeld und Sparguthaben stattfindet: Viele sind durchaus willens, den Anteil rentabler Anlageformen zu erhöhen. Die Entwicklung an den Kapitalmärkten in den vergangenen drei Jahren gibt ihnen aber gefühlt keine Gelegenheit dazu: Weil alle Indizes von deutschen Staatsanleihen über Ramschpapiere bis hin zum Deutschen Aktienindex DAX eine annähernd störungsfreie Linie von links unten nach rechts oben im Chart entsprechen. Und natürlich niemand der Trottel sein möchte, der sich zu Höchstkursen dazu durchringt, ein klein wenig ins Risiko zu gehen.
Nun wird niemand mit Bestimmtheit sagen können, ob oder wann dieser merkwürdige „Alles“-Boom endet. Hier dennoch drei konstruktive Vorschläge für Anleger, egal, ob sie investiert sind oder nicht, wie sie mit der Lage umgehen können.
1. Volatilität kaufen
Es gibt – anders, als man intuitiv vermuten könnte – tatsächlich noch eine Anlageform, die historisch niedrig bewertet ist. Es ist die Volatilität, also die tatsächlichen und die erwarteten Schwankungen der Aktien- und Anleihenmärkte. Gemessen wird sie in Form von wenig bekannten Volatilitätsindizes wie etwa dem „VDAX“ für den DAX oder den „VIX“ für US-Standardwerte oder dem „MOVE“-Index für US-Staatsanleihen. Selten war die Nervosität der Marktteilnehmer so niedrig wie derzeit.
Wer glaubt, dass sich dies bald ändert, hat zwei Möglichkeiten, die sich allerdings nur für erfahrene und risikobereite Anleger eignen: Entweder gezielt Investmentprodukte beimischen, deren Entwicklung direkt an die Volatilität gekoppelt ist – dazu gibt es eigene Indexprodukte. Oder aber spekulativ zu Put-Optionsscheinen greifen, falls Anleger nicht nur an einen Anstieg der Nervosität, sondern auch fallende Kurse glauben. Denn wie teuer eine Spekulation auf fallende Kurse ist, hängt entscheidend von der Volatilität ab, sie ist ebenso preisbildend wie die Kursveränderungen selbst. In Zeiten geringer Nervosität wie derzeit ist die Spekulation auf fallende Kurse oder die Absicherung gegen Einbrüche günstig.
2. Korrelationen misstrauen
Im laufenden Bullenmarkt gelten alte Zusammenhänge nicht mehr: Bewegten sich Aktien und Anleihen lange Zeit invers zueinander – weil Anleihen als sicher und Aktien als riskant gelten – klettern beide Anlageklassen seit Jahren im Gleichschritt, unter anderem befeuert von der aggressiven Notenbankpolitik. Was indes für den Aufschwung gilt, gilt auch für eine mögliche Krise: Beide Anlageformen könnten zugleich an Wert verlieren und für ein böses Erwachen bei jenen Anlegern sorgen, die sich mit einem Mix aus langlaufenden Anleihen und Aktien auch gut gerüstet für einen Einbruch sehen. Denkbar wäre dieses Szenario etwa für eine Vertrauenskrise am Anleihenmarkt, falls Zweifel an der Schuldentragfähigkeit größerer Länder aufkeimen – aber auch im Falle unerwartet rascher Zinserhöhungen etwa in den USA oder Großbritannien.
Schon einmal - im Zuge der Finanzkrise 2008 – hat sich gezeigt, dass verschiedene Anlageformen wie Aktien, Gold, Private Equity oder Unternehmensanleihen über Jahre oder Jahrzehnte schwach miteinander korrelieren können - aber plötzlich ausgerechnet dann zeitgleich einbrechen, wenn man die schwachen Korrelationen am nötigsten brauch. Das spricht nicht gegen die Wichtigkeit von Diversifikation bei der Anlage, sondern vor allem gegen überzogene Erwartungen.
3. Garantieprodukten misstrauen
Deutsche Anleger werden gerne als finanziell ungebildet, viel zu sicherheitsorientiert und prozyklisch beschimpft. Es gibt indes auch einige Dinge, die sie richtig machen – zum Beispiel die Finger von kapitalgarantierten Produkten zu lassen. Denn laut Investmentstatistik des Fondsverbands BVI fließen aus Garantiefonds weiter Mittel ab beziehungsweise werden auslaufende Garantieprodukte nicht verlängert - 1 Mrd. Euro zogen Anleger 2013 netto aus Garantiefonds ab, weitere 720 Mio. Euro in den ersten fünf Monaten 2014. Zu recht: An den Finanzmärkten risikofrei Rendite verdienen zu wollen, ist die Quadratur des Kreises.
Die extrem niedrigen Zinsen machen es den Produktanbietern schwer, Anlegern eine Kapitalgarantie zu bieten – denn Garantieprodukte sind stets ein Mix aus einer risikolosen Zinsanlage und Optionen für die Rendite. Bei niedrigen Zinsen bleibt Anbietern aber kaum Geld für jenen Teil der Garantieprodukte, der für die Rendite sorgen soll. Bereinigt um mögliche Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren haben Anleger mit Garantieprodukten kaum Chancen auf Renditen jenseits von Tagesgeldkonten. Mischfonds oder eine Kombination aus sicheren Spareinlagen und kleineren Beimischungen von Aktienfonds sind die bessere Wahl als ein Garantieprodukt.